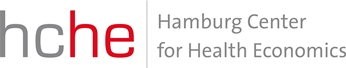Forschung
Über 80 Ökonom:innen und Mediziner:innen forschen täglich gemeinsam am HCHE an Lösungen für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Diese Interdisziplinarität schafft die Basis für exzellente gesundheitsökonomische Forschung.
Das HCHE nutzt darüber hinaus die umfangreiche methodische Expertise seiner Mitglieder, um gesundheitsökonomische Evidenz zu erzeugen, die wissenschaftlichen Anspruch mit praktischen Implikationen für Politik und Entscheidungsträger verbindet. Sieben Bereiche stehen im Mittelpunkt der Forschung:

Bevölkerungsgesundheit
Im Zentrum dieses Forschungsbereiches stehen folgende Themenfelder: Ökonomie psychischer Erkrankungen, Gesundheit und Altern und Ökonomie der Adipositas.
Wir testen Instrumente zur Messung von Kosten und gesundheitlichen Effekten und analysieren die Kosteneffektivität von neuen Therapieverfahren und Versorgungsprogrammen für psychisch Kranke. Dabei greifen wir auf Daten aus randomisiert kontrollierten Multicenterstudien, Routinedaten und auch modellgestützte Analysen zurück. Unsere Analysen umfassen Krankheitskosten und ökonomische Evaluationen bei Depressionen, psychotischen Störungen, Demenzen, Essstörungen, Angststörungen und Abhängigkeitserkrankungen und decken somit nahezu das gesamte Spektrum psychiatrischer Erkrankungen ab.
Wir analysieren die Inanspruchnahme und die Kosten von formellen und informellen Gesundheitsleistungen sowie die privaten Zuzahlungen in repräsentativen Stichproben der älteren Bevölkerung sowie ausgewählten älteren Patientenstichproben, beispielsweise mit Multimorbidität, Demenz oder Osteoporose. Die Datenanalyse erfolgt unter Verwendung statistischer Verfahren für Querschnittanalysen als auch Längsschnittanalysen mit dem Ziel, Prädiktoren für die ökonomischen Zielgrößen zu identifizieren.
Adipositas geht aufgrund der hohen Prävalenz und einer Vielzahl assozierter Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes mellitus Typ2 und Hypertonie, mit einer enormen Krankheitslast einher, die wir anhand von Krankheitskostenstudien für bestimmte Populationen quantifizieren. Da Adipositas das Risiko für viele weitere Krankheiten zum Teil sehr stark erhöht, wurde weltweit bereits eine Vielzahl an präventiven und therapeutischen Interventionen für adipöse Menschen entwickelt. Basierend auf entscheidungstheoretischen Modellierungen analysieren wir die Kosteneffektivität solcher Interventionen für lange Zeithorizonte.
Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesens
Im Zentrum dieses Forschungsschwerpunktes stehen drei Themenkomplexe: Optimale Krankenversicherungsverträge, Finanzierung und Gestaltung sozialer Krankenversicherungssysteme und Nachfrage nach Pflegeversicherung.
Krankenversicherungsverträge sichern finanzielle Risiken durch Krankheit ab und ermöglichen den Zugang zu teuren Therapien. Gleichzeitig ändern sie die Anreize der Versicherten, Vorsorge zu betreiben und medizinische Leistungen effizient in Anspruch zu nehmen. Wir untersuchen die Wirkungen unterschiedlicher Krankenversicherungsverträge und entwickeln Modelle zur optimalen Gestaltung der Krankenversicherung.
Soziale Krankenversicherungssysteme können auf unterschiedliche Weise finanziert werden: durch einkommensabhängige Beiträge, Kopfpauschalen oder steuerfinanzierte Subventionen. Wir untersuchen die Wirkungen der unterschiedlichen Finanzierungsformen und entwickeln Modelle zur optimalen Gestaltung von Sozialversicherungssystemen.
Trotz einer hohen Wahrscheinlichkeit, im Alter pflegebedürftig zu werden, ist die Nachfrage nach privaten Pflegeversicherungen äußerst gering. Dies hat erhebliche Auswirkungen in einer alternden Gesellschaft. Wir untersuchen die Ursachen und Folgen für die geringe Nachfrage. Insbesondere verwenden wir Ansätze aus der Verhaltensökonomie.
Gesundheitsökonomische Evaluation
Wir evaluieren Interventionen, die die Organisation der Versorgung von Patient:innen im Gesundheitssystem verändern. Diese Interventionen können z.B. Disease Management Programme, Case Management Programme oder andere innovative Ansätze für das Management der Versorgung von Patienten sein. Hierfür verwenden wir Kosten-Effektivitäts-Analysen, Kosten-Nutzwert-Analysen und Kosten-Nutzen-Analysen sowie Matchingverfahren und andere Methoden zur Adjustierung von Risiken zwischen Interventions- und Kontrollgruppe.
In Zusammenarbeit mit medizinischen Fachpersonal führen wir Krankheitskostenstudien zu verschiedenen Indikationen durch. Je nach Zielsetzung bzw. Perspektive der Studie sowie der betrachteten Krankheit werden direkte medizinische Kosten, direkte nicht-medizinische Kosten sowie indirekte Kosten einbezogen und unterschiedliche Ansätze, z.B. Bottom-up oder Top-down, zur Ermittlung der Gesamtkosten herangezogen. Um die Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen, wenden wir statistische Verfahren wie die Monte-Carlo-Simulation an.
Die Standardmethoden der Kosten-Nutzen-Bewertung treffen einschränkende Annahmen bezüglich der Verteilung der Vorteile aus Gesundheitsmaßnahmen. Umfragen zeigen jedoch, dass Bürger:innen auch auf die Verteilung der Vorteile von Gesundheitsmaßnahmen Wert legen. Wir entwickeln deshalb Methoden, welche die Verteilungswirkungen berücksichtigen.
Im Rahmen der gesundheitsökonomischen Evaluationsforschung setzen wir auf die Anwendung mathematisch-statistischer Verfahren zur Bewertung von innovativen Versorgungsformen und Therapien; stets mit dem Ziel überlegene Handlungsalternativen zu identifizieren. Dabei kommen beispielsweise Entscheidungsbaummodelle, Markov-Prozesse, probabilistische Simulationen und andere Methoden zur unterstützenden Entscheidungsanalyse zur Anwendung.
Die Zunahme von Post-Zulassungsstudien, sogenannten Phase-IV-Studien, hat zu einem neuen Anwendungsgebiet für Routinedaten geführt. Wir entwickeln Methoden, diese Daten, z.B. von Krankenkassen in der gesundheitsökonomischen Evaluation zu verwenden. Hierzu gehören unter anderem die Adaption oder (Weiter-)Entwicklung von Methoden zur Risikoadjustierung zwischen Interventions- und Kontrollgruppe bei nicht-randomisierten Studien, z.B. Propensity-Score-Matching oder Risikoscores, Konzepte zur Messung von krankheitsspezifischen Endpunkten oder wichtiger Einflussfaktoren, z.B. Compliance, mit Routinedaten sowie die Anwendung ökonometrischer Modelle.
Fachkräfte im Gesundheitswesen
In vielen Industrieländern sinkt das Fachkräfteangebot. Dieser Trend ist vor allem auf die Alterung der Bevölkerung zurückzuführen, wird aber in letzter Zeit durch den wachsenden Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten verstärkt. Besonders betroffen sind die Gesundheits- und Pflegemärkte. Hier führt die Bevölkerungsalterung zusätzlich zu einem Anstieg der Nachfrage. Darüber hinaus ist eine erhebliche Fehlverteilung der vorhandenen Fachkräfte im Gesundheitswesen zu beobachten. Engpässe beim Arbeitskräfteangebot auf den Gesundheits- und Pflegemärkten finden wegen ihrer potenziell negativen Folgen für die Patient:innen in der Öffentlichkeit große Beachtung. Daher müssen politische Entscheidungsträger weltweit Strategien entwickeln, um sicherzustellen, dass das Angebot an Arbeitskräften ausreichend ist, um die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen zu decken. Dazu gehören auch Strukturreformen, die über die Koordination und Ambulantisierung den Bedarf an Arbeitskräften reduzieren.
Märkte für Arzneimittel
Die Preisregulierung von Arzneimitteln steht im Spannungsfeld von statischer und dynamischer Effizienz. Statische Effizienz erfordert, dass der Preis den Grenzkosten entspricht, während dynamische Effizienz bedingt, dass forschende Unternehmen ausreichende Gewinne erzielen, wenn sie ein wirksames Medikament entwickeln. Wir untersuchen, wie unterschiedliche Methoden der Preisregulierung sich auf dieses Spannungsfeld auswirken.
Der Trend zur Begrenzung der Ausgaben für Arzneimittel in Gesundheitssystemen führte zu einer starken Regulierung des Arzneimittelmarktes. Wir analysieren die Folgen von Politikmaßnahmen, z.B. der Festbeträge, der generischen Substitution, der Arzneimittelrichtgrößen und der Rabattverträge vor dem Hintergrund der mit der jeweiligen Regulierung verbundenen Politikziele. Hierbei fokussieren wir auf Veränderungen bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen durch betroffene Patient:innen, krankheitsspezifische Outcomes und etwaige Folgekosten.
Der Trend, das Wachstum der Ausgaben auf dem Gesundheitsmarkt zu begrenzen, und die zunehmende Regulierung des Arzneimittelmarktes haben zu Veränderungen des Wettbewerbsumfeldes für die pharmazeutische Industrie geführt. Je nach Marktsegment haben die Unternehmen unterschiedliche Strategien entwickelt, um sich auf die Herausforderungen einzustellen. Wir analysieren und bewerten den Erfolg dieser Unternehmensstrategien, insbesondere der veränderten Preis- und Markteintrittsstrategien sowie Änderungen im operativen Marketing.
KI & Digital Health
Durch zunehmende Digitalisierung werden im Gesundheitswesen immer mehr große und neuartige Datensätze verfügbar, die neue spannende Forschungsfragen eröffnen.
Im Rahmen des Forschungsfeldes KI & Digital Health sollen zum einen Methoden zur Analyse großer Datensätze weiterentwickelt und zum anderen auf wichtige Fragen der Gesundheitsökonomie angewendet werden.
Das Forschungsfeld besteht aus methodischen und angewandten Bereichen:
1) Grundlagenbereich / Methodenbereich: Weiterentwicklung von Verfahren des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz; insbesondere zur Schätzung kausaler Effekte
2) Anwendungsbereich:
a. Anwendung von modernen Methoden des maschinellen Lernen auf Datensätze des Gesundheitswesens
b. Analyse des Einflusses von Digitalisierung auf den Gesundheitsmarkt, u.a. Telemedizin
Ambulante und stationäre Versorgung
Vergleichende Untersuchungen zur Performanz von Gesundheitssystemen sowie von Organisationen im Gesundheitswesen haben stark an Bedeutung gewonnen, um einen sachgerechteren Einsatz der knappen finanziellen Mittel im Gesundheitswesen zu gewährleisten. Wir verwenden eine Vielzahl von methodischen Ansätzen (parametrische vs. nicht-parametrische Verfahren), sowie unterschiedliche Performanzkriterien (Kriterien der Effektivität und/oder der Effizienz), um die Performanz von Organisationen zu untersuchen.
Vergütungssysteme für Krankenhäuser und Ärzt:innen setzen Anreize, wie Patient:innen behandelt werden. Unter dem Gesichtspunkt der Kostenkontrolle haben prospektive Systeme Vorteile. Allerdings können sie dazu führen, dass die Behandlungsqualität zurückgeht und dass Patient:innen unnötig behandelt oder abgewiesen werden. Wir untersuchen die Wirkungen unterschiedlicher Vergütungssysteme und entwickeln Modelle zur optimalen Gestaltung von Vergütungssystemen.
Zunehmender Wettbewerbsdruck zwischen Krankenhäusern hat zu einer Neuausrichtung des Krankenhausmanagements geführt. Krankenhäuser nutzen zunehmend sehr ausgefeilte Instrumente des strategischen Managements, um sich auf dem Markt zu behaupten bzw. zu positionieren. Strategisches Management von Krankenhäusern umfasst eine große Bandbreite von Instrumenten, u.a. Übernahmen/Privatisierungen, Netzwerkentwicklung und Spezialisierung. Wir analysieren den Einfluss des Einsatzes von Instrumenten des strategischen Managements von Krankenhäusern auf Effizienz, Produktivität und Versorgungsqualität. Dabei nutzen wir moderne ökonometrische Methoden, um Erkenntnisse zu gewinnen, die für Krankenhäuser nutzbar gemacht werden können.