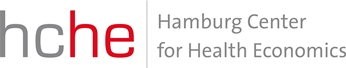Pressemitteilungen
Sinnstiftend, aber familienfeindlich? Große Diskrepanz bei Berufen im Gesundheitssektor trifft vor allem Frauen (20.01.2026)
Pressemeldung vom 20. Januar 2026
Sinnstiftend, aber familienfeindlich? Große Diskrepanz bei Berufen im Gesundheitssektor trifft vor allem Frauen
In einer aktuellen Studie haben Forschende des HCHE/Universität Hamburg und der KU Leuven (Belgien) den niederländischen Arbeitsmarkt untersucht und herausgefunden, dass sowohl Flexibilität in Bezug auf die berufliche Tätigkeit als auch Sinn und Bedeutung des jeweiligen Berufs sehr hoch bewertet werden und dass vor allem Frauen beides stärker bevorzugen als Männer. Und doch spiegeln sich diese Präferenzen nicht in den gewählten Berufen von Frauen wider. Jobs im Gesundheitssektor zählen mit deutlichem Abstand zu den am häufigsten gewählten Tätigkeiten von Frauen und bieten, bei einer hohen sinnstiftenden Identifikation, gleichzeitig relativ wenig Flexibilität. Auf Dauer kann eine derartige Diskrepanz zu Unzufriedenheit und damit auch zum Abwandern in andere Berufe führen – vor dem Hintergrund des steigenden Bedarfs an Arbeitskräften im Gesundheitswesen eine fatale Fehlentwicklung. Die Ergebnisse aus den Niederlanden lassen sich auch auf den deutschen Arbeitsmarkt übertragen.
Frauen wählen eher sinnstiftende Berufe als Männer. Berufe mit einem hohen Anteil an zwischenmenschlicher Interaktion werden auch mit einem hohen Maß an Sinnhaftigkeit und Bedeutung verbunden. Beides findet sich vor allem in den Sektoren Gesundheit und Bildung. Über 30% aller berufstätigen niederländischen Frauen sind im Gesundheitswesen tätig, im Gegensatz zu rund 10% aller berufstätigen niederländischen Männer. Damit zählt die Gesundheitsbranche mit weitem Abstand als der von weiblichen Arbeitskräften am häufigsten gewählte Sektor auf dem Arbeitsmarkt. Es folgt der Bildungssektor mit einem Anteil weiblicher Arbeitskräfte von ca. 12% (bei ca. 9% männlichen Arbeitskräften).
Ein weiteres Ergebnis der Studie aus den Niederlanden: Vor allem Frauen mit Kindern wünschen sich mehr Flexibilität im Job, um Familie und Berufstätigkeit besser miteinander vereinbaren zu können, denn noch immer leisten Frauen, wie auch in den meisten westlichen Industrieländern, einen größeren Anteil an Familien- und Hausarbeit. In der Realität ist es jedoch so, dass gerade die sinnstiftenden Berufe im Gesundheits- und Bildungswesen, also Jobs mit einem hohen Maß an zwischenmenschlicher Interaktion wie etwa im Patientenkontakt oder im Schulsystem, wenig Spielraum für eine flexible Anpassung von Arbeitszeiten und Homeoffice bieten. Insgesamt haben Frauen aufgrund ihres relativ hohen Anteils an Jobs im Gesundheitssektor deutlich seltener als Männer die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten (23,3 % gegenüber 33,6 %) oder ihre Arbeitszeiten anzupassen (32,8 % gegenüber 41,1 %). Wenn die Möglichkeit zu einer flexibleren Arbeitszeitgestaltung nicht gegeben ist, bleibt für viele Frauen als Ausweg häufig nur die Reduzierung auf Teilzeit oder im schlechtesten Fall ein Abwandern in andere Berufe.
„Die Erhöhung der Arbeitszufriedenheit durch bessere und vor allem flexiblere Arbeits-bedingungen wie die Möglichkeit zu Telearbeit sowie attraktive Teilzeitmodelle können zur Erhaltung und Freisetzung vorhandener Potentiale beitragen und damit die zunehmende Verschärfung des Personalengpasses im Gesundheitssektor abmildern“, so die Studien-Autorin Prof. Dr. Iris Kesternich vom Hamburger Center for Health Economics der Universität Hamburg.
In der empirischen Analyse wurden Daten der niederländischen Longitudinal Internet Studies for the Social Sciences (LISS) und des International Social Survey Programme (ISSP) ausgewertet. Die Ergebnisse aus den Niederlanden lassen sich in Bezug auf die geschlechterspezifischen Präferenzen in der Berufswahl auf einen Großteil der westlichen Industrienationen übertragen
Trend zu Teilzeittätigkeit auch in Deutschland
Auch in Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild. Vor dem Hintergrund eines bereits bestehenden Fachkräfteengpasses im Gesundheitssektor wird bis zum Jahr 2040 vor allem aufgrund des demographischen Wandels eine Zunahme des Bedarfs an Arbeitskräften von rund einer Million Erwerbstätigen prognostiziert.
„Wenn auch vor dem gesamtgesellschaftlichen Hintergrund einer sich schnell verändernden Arbeitswelt eine Rückkehr zu hohen Vollzeitraten im Gesundheitswesen nicht zu erwarten ist, sollte das Ziel vor allem sein, sowohl Beschäftigte im System zu halten, als auch weiterhin Menschen für eine Arbeit im Gesundheitswesen zu gewinnen“, beurteilt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center for Health Economics, die Situation.
Denn ein anhaltender Fachkräfteengpass bei gleichzeitiger Fluktuation und steigendem Bedarf kann erhebliche negative Auswirkungen auf die Produktivität der Gesundheitsbranche sowie gesamtwirtschaftlich auf das Bruttoinlandsprodukt haben. Überdurchschnittlich hohe erkrankungsbedingte Fehlzeiten und Frühverrentung in der Pflege verursachen hohe Kosten sowohl für die Leistungserbringer als auch für die Gesellschaft. Zusätzliche hohe Kosten entstehen, wenn versucht wird, vorhandene Lücken in der Personalausstattung mit Leiharbeitskräften oder mit über- oder außertariflich bezahlten Arbeitsverträgen zu füllen. Durch die sich verschärfende Situation geraten Unternehmen in einen Zustand der Lähmung bei hohem kurz- und langfristigen Handlungsdruck und wenig Planungsmöglichkeiten. Eine Verbesserung der Personalsituation ist somit eines der drängendsten Probleme, das von Politik und Entscheidungsträgern angegangen werden sollte.
Um die Attraktivität des Gesundheitssektors auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und Arbeitskräfte langfristig zu halten, könnte daher – jenseits von monetären Anreizen – auch die Vereinbarkeit von Sinnhaftigkeit und Flexibilität im Beruf in den Blick genommen werden: Vor allem eine Flexibilisierung sinnstiftender Arbeitsplätze im Gesundheitswesen kann die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität auf dem Arbeitsmarkt verringern.
Zur vollständigen Studie „Work Meaning and the Flexibility Puzzle” geht es hier: https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/739081
Über das HCHE
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mit mehr als 90 Wissenschaftler:innen zählt es zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Die Forschenden beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesens, gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, ambulante und stationäre Versorgung, KI und Digital Health, Bevölkerungsgesundheit und Fachkräfte im Gesundheitswesen.
Für Rückfragen: Hannes Rathjen, Hamburg Center for Health Economics,
Tel. 040 2395-29516, hannes.rathjen@uni-hamburg.de
Preise für junge Forschende in der Gesundheitsökonomie verliehen (16.05.2025)
Pressemeldung vom 16. Mai 2025
Preise für junge Forschende in der Gesundheitsökonomie verliehen
Am 16. Mai 2025 wurden die diesjährigen HCHE Young Researcher Awards des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) verliehen. Preisträger:innen sind mit Fabian Grünwald, Benedicta Herrmanns, Carolin Brinkmann und Jona Frasch vier Promovierende im Bereich der Gesundheitsökonomie. Die Wissenschaftler:innen wurden für ihre herausragenden Arbeiten in den Themengebieten Arzneimittelmärkte, Bevölkerungsgesundheit und stationäre Versorgung ausgezeichnet. Eine internationale Jury verleiht im zweijährigen Turnus die HCHE Young Researcher Awards. Neben der Auszeichnung sind die Preise mit der Möglichkeit eines Forschungsaufenthalts an einer internationalen Forschungseinrichtung bei einem der Jury-Mitglieder dotiert.
Wissenschaft lebt von den Ideen junger Forscherinnen und Forscher. Um die Arbeiten der Promovierenden am HCHE zu fördern, vergibt der Wissenschaftliche Beirat des HCHE seit 2021 alle zwei Jahre Preise für die besten gesundheitsökonomischen Paper. Im Jahr 2023 konnten drei junge Wissenschaftler:innen ausgezeichnet werden, in diesem Jahr sind es sogar vier. Die Preisträger:innen sind Promovierende der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf und zugleich Mitglieder des Hamburg Center for Health Economics.
Im Rahmen seine Dissertation an der Universität Hamburg erhält Fabian Grünwald den HCHE Young Researcher Award 2025 für seine exzellente Forschungsarbeit über die Wirkung des europäischen Zulassungsverfahren bei Arzneimitteln auf die Zeit bis zum Markteintritt. Jury-Mitglied Prof. Dr. Dorte Gyrd-Hansen von der University of Southern Denmark unterstreicht die Sorgfalt der Ursachenanalyse und die politische Relevanz der Ergebnisse: „Die Studie stellt den ersten erfolgreichen Versuch dar, zu untersuchen, wie der Beitritt zur EU und die Teilnahme an den zentralisierten Regulierungsprozessen der EU den Zugang der Patienten zu Arzneimitteln in neuen Mitgliedstaaten verbessern können. Grünwald und Co-Autoren stellen fest, dass die EU-Mitgliedschaft die Verzögerung der Markteinführung um fast elf Monate deutlich verkürzt. Interessanterweise scheint dieser Effekt hauptsächlich auf eine schnellere Akzeptanz von Arzneimitteln zurückzuführen zu sein, die nicht in den obligatorischen Anwendungsbereich des Verfahrens der Europäischen Arzneimittelagentur fallen.“ Grünwald arbeitet mittlerweile bei Astellas Pharma und beschäftigt sich als Value & HTA Manager mit der Nutzenbewertung von Arzneimitteln im Rahmen des ANMOG-Verfahrens.
Ebenfalls ausgezeichnet wurde Benedicta Hermanns von der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg, die in einer experimentellen Studie herausfinden konnte, dass Einstellungen in Bezug auf Risikobereitschaft und Prosozialität das gesundheitsbezogene Verhalten der Bevölkerung vorhersagen können. „Präventives Verhalten ist entscheidend für die Eindämmung der Ausbreitung von Infektionskrankheiten, wie die COVID-19-Pandemie gezeigt hat. Die Ergebnisse von Benedicta Hermanns unterstreichen die Bedeutung der Berücksichtigung prosozialer Motive bei der Untersuchung von Gesundheitsverhalten und der Entwicklung wirksamer öffentlicher Gesundheitspolitik“, so Jury-Mitglied Prof. Dr. Aleksandra Torbica von der Bocconi Universität in Mailand. Herrmanns forscht inzwischen am Institute for Digital Economics der TU Hamburg.
Den dritten Platz teilen sich Carolin Brinkmann von der Universität Hamburg und Jona Frasch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Carolin Brinkmann hat sich mit den monetären Bewertungskriterien von Lebensqualität und konkret mit der Bewertung von Lebensjahren in Bezug auf das Wohlbefinden beschäftigt. „Gesundheitsökonomen verwenden seit vielen Jahren das qualitätsbereinigte Lebensjahr (QALY) zur Messung von Gesundheitsergebnissen. Da sich der Umfang wirtschaftlicher Bewertungen zunehmend erweitert etwa auf Bereiche wie das Sozialwesen oder die psychische Gesundheit, ist es besonders wichtig, diese zusätzlichen Vorteile zu messen. Carolin Brinkmanns Forschung zielt darauf ab, Lebensqualität des Einzelnen zu erfassen, die oft als Wohlbefinden bezeichnet wird“, so Jury-Mitglied Prof. em. Dr. Friedrich Breyer von der Universität Konstanz.
Jona Frasch vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf untersuchte den durch Extremtemperaturen verursachten Kostenanstieg aufgrund notfallbedingter Krankenhausaufnahmen. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass extreme Temperaturen der Gesundheit schaden und erhebliche Kosten im Gesundheitswesen verursachen. „Die Auswirkungen des Klimawandels zeichnen sich nicht nur durch Veränderungen und Schäden an der Umwelt ab, sie haben auch ganz konkrete Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung sowie das Gesundheitssystem und verursachen hohe Folgekosten“, so Jury-Mitglied Prof. Dr. Mark Sculpher von University of York.
Prof. Dr. Mathias Kifmann, Kernmitglied am HCHE, formuliert mit der Preisvergabe das Anliegen des Zentrums: „Wir würden uns sehr freuen, wenn die HCHE Young Researcher Awards unsere Preisträger:innen in der wissenschaftlichen Entwicklung unterstützen und zu weiterer Forschung ermutigen. Mit den Auszeichnungen dieser vier so unterschiedlichen Forschungsarbeiten wird zudem die große Bandbreite an gesundheitsökonomischen Themen deutlich.“
Über das HCHE
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mit mehr als 90 Wissenschaftler:innen zählt es zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Die Forschenden beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung und Organisation des Gesundheitswesens, gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, ambulante und stationäre Versorgung, KI und Digital Health, Bevölkerungsgesundheit und Fachkräfte im Gesundheitswesen.
Für Rückfragen: Hannes Rathjen, Hamburg Center for Health Economics, Tel. 040 42838-9516, hannes.rathjen@uni-hamburg.de
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung von Krankenhäusern, Eingriffe ambulant durchzuführen? (27.02.2025)
Pressemeldung vom 27. Februar 2025
Welche Faktoren beeinflussen die Entscheidung von Krankenhäusern, Eingriffe ambulant durchzuführen?
Ein Forschungsteam des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg hat neue Erkenntnisse gewonnen, welche Faktoren das Angebot ambulanter Krankenhausleistungen in Deutschland beeinflussen. Obwohl ambulante Leistungen deutschlandweit einheitlich vergütet werden, gibt es erhebliche Unterschiede im Umfang der ambulanten Versorgung in der deutschen Kliniklandschaft. Faktoren wie das Leistungsspektrum eines Krankenhauses, dessen Größe, die Infrastruktur der Notfallversorgung und vor allem die Anzahl der durchgeführten Eingriffe spielen eine große Rolle. Aber auch demografische und sozioökonomische Einflüsse, wie der Anteil an Single-Haushalten in der Region und die daraus abgeleitete Möglichkeit adäquater Nachsorge wurden in der Analyse als Gründe identifiziert. Die Ergebnisse liefern Entscheidungsträgern wichtige Einsichten zur Förderung von ambulanten Leistungen.
Dank des medizinischen Fortschritts der letzten Jahre können immer mehr Verfahren, die früher auf die stationäre Versorgung beschränkt waren, heute ambulant durchgeführt werden. Das entspricht auch dem politischen Wunsch einer stärkeren Verlagerung der Versorgung aus dem ressourcenintensiven stationären Bereich in den effizienteren ambulanten Bereich. Außerdem kann so das an anderer Stelle dringend benötigte Personal entlastet werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern hat Deutschland hier aber noch einen hohen Nachholbedarf. So wurden im Jahr 2019 in Deutschland immer noch etwa 40 % der Eingriffe, die nach deutschem Recht sowohl von niedergelassenen Fachärzten als auch von Krankenhäusern ambulant durchgeführt werden dürften, nach wie vor stationär durchgeführt. Bei einer Reihe von Eingriffen ist die stationäre Rate sogar noch höher: 80 % aller Hernienoperationen werden stationär durchgeführt, in Nachbarländern wie den Niederlanden und Dänemark sind es nur 15 %.
Um herauszufinden, welche Gründe es trotz eines einheitlichen Vergütungssystems für die Unterschiede im ambulanten Angebot von Krankenhäusern gibt, hat das Forschungsteam um Robert Messerle vom Hamburg Center for Health Economics zunächst Gesundheitsexperten und Praktiker befragt, um mögliche Einflussfaktoren zu identifizieren. Anschließend folgte eine umfassende quantitative Analyse von Daten aller deutschen Krankenhäuser.
Standen bisher vor allem finanzielle Anreize im Fokus für den immer noch hohen stationären Anteil an Leistung in Krankenhäusern, konnten nun weitere, zusätzliche Faktoren gefunden werden. „Der stärkste Zusammenhang, jedenfalls von den Variablen, die wir messen können, besteht nach unseren Ergebnissen bei der Erfahrung mit einer Prozedur. Wie oft führt ein Krankenhaus einen bestimmten Eingriff insgesamt durch (egal, ob ambulant oder stationär)? Je mehr Erfahrung ein Krankenhaus mit einer bestimmten Leistung hat, desto größer scheint die Bereitschaft zu sein, diese Leistung auch ambulant zu erbringen“, so Robert Messerle.
Darüber hinaus wurde die Verfügbarkeit adäquater ambulanter Strukturen und Prozesse sowie qualifizierten Personals als Beispiele für wichtige Faktoren in den Interviews genannt. Auch auf die Bedeutung „softer“ Faktoren wie individuelle Erfahrungen und Präferenzen der Mitarbeitenden / Ärzt:innen wurde in Befragungen hingewiesen.
Viele der in den Interviews genannten Faktoren fanden sich in den Ergebnissen der Datenanalyse wieder. Die quantitativen Ergebnisse bestätigen, dass Faktoren wie das Leistungsspektrum eines Krankenhauses, dessen Größe, die Anzahl der durchgeführten Eingriffe und die Infrastruktur der Notfallversorgung eine große Rolle spielen. Auch demografische und sozioökonomische Faktoren, wie der Anteil an Einpersonenhaushalten in der Region und damit das potentielle Fehlen eines familiären Netzes bzw. die Möglichkeit adäquater Nachsorge, wurden in der Analyse als wichtige Einflüsse gemessen.
Folgende Faktoren beeinflussen die Entscheidung von Krankenhäusern, Eingriffe ambulant durchzuführen:
Krankenhaus-interne Faktoren
- Erfahrung mit einer bestimmten Prozedur/Leistung
- Ambulante Infrastruktur der Krankenhäuser
- Betten- und Personalkapazität der Krankenhäuser
- Leistungsspektrum der Krankenhäuser
- Größe der Krankenhäuser
- Notfallversorgung in den Krankenhäusern
- Finanzielle Situation der Krankenhäuser
Krankenhaus-externe Faktoren
- Sozioökonomische, demographische und medizinische Charakteristika der Patient:innen
- Verfügbarkeit von qualifiziertem Pflegepersonal
- Standort / Krankenhausdichte und Konkurrenz
- Regionale ambulante Versorgungsinfrastruktur
- Intensität der Abrechnungsprüfung durch Krankenkassen
Zusammenfassend unterstreicht die Studie die Notwendigkeit, vielfältige Faktoren im Rahmen gesundheitspolitischer Reformen zu adressieren, um die Effektivität und Effizienz der Versorgung nachhaltig zu steigern. Ein alleinige Fokussierung auf die finanziellen Anreize greift daher zu kurz.
Zur vollständigen Studie “Which factors influence the decision of hospitals to provide procedures on an outpatient basis? – Mixed-methods evidence from Germany” geht es hier: https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2024.105193
Für Rückfragen: Hannes Rathjen, Hamburg Center for Health Economics, Tel. 040 42838-9516, hannes.rathjen@uni-hamburg.de
Harvard-Professorin forscht 2025 am HCHE der Universität Hamburg (13.01.2025)
Pressemitteilung vom 13. Januar 2025
Alexander von Humboldt-Stiftung fördert gemeinsame Forschung mit Harvard University
Prof. Marcella Alsan von der Harvard University erhält den Humboldt-Forschungspreis. Gemeinsam mit Prof. Dr. Jonas Schreyögg und Dr. Esra Bayindir vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg wird sie im Rahmen der Förderung zu Ungleichheiten im deutschen Gesundheitssystem forschen.
Das internationale Forschungsteam wird am HCHE die Flüchtlingsbewegung von 2015/16 und deren Implikationen für das Gesundheitssystem und die Versorgungsqualität untersuchen. Starten soll das Kooperationsprojekt im Laufe des Jahres 2025.
Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Professor für Management im Gesundheitswesen an der Universität Hamburg und wissenschaftlicher Direktor des HCHE: „Diese besondere Förderung und die gemeinsame Forschung geben uns eine unschätzbare Gelegenheit für bedeutende Fortschritte in der gesundheitsökonomischen Forschung und darüber hinaus positive Impulse für die Gesundheitsversorgung“.
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ehrt mit ihrem Preis führende Forscherinnen und Forscher, „deren grundlegende Entdeckungen, neue Theorien oder Einsichten einen bedeutenden Einfluss auf ihr eigenes Fachgebiet und darüber hinaus haben und von denen erwartet wird, dass sie weiterhin wissenschaftliche Spitzenleistungen erbringen“. Der Preis ist mit 60.000 Euro dotiert.
Die innovative Arbeit von Marcella Alsan als angewandte Mikroökonomin und Spezialistin für Infektionskrankheiten findet in der Wissenschaft breite Anerkennung. So erhielt sie bereits zuvor das MacArthur Fellowship für ihre Forschung über Diskriminierung im Gesundheitsbereich. Im Jahr 2022 wurde sie zum Mitglied der National Academy of Medicine gewählt.
Über das HCHE
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mit mehr als 80 Forschenden ist es eines der größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Die Forschenden beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung des Gesundheitswesens, gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, ambulante und stationäre Versorgung, Big Data und Digital Health sowie Bevölkerungsgesundheit.
Für Rückfragen: Andrea Bükow, Universität Hamburg, Hamburg Center for Health Economics, Tel. 040 42838-9515: andrea.buekow@uni-hamburg.de
Extremtemperaturen führen zum Anstieg notfallbedingter Krankenhausaufnahmen (27.11.2024)
Pressemitteilung, 27. November 2024
Extremtemperaturen führen zum Anstieg notfallbedingter Krankenhausaufnahmen und jährlicher Kosten von rund 174 Mio. Euro. Klimapolitik kann Gesundheitskosten reduzieren
Vor dem Hintergrund des Klimawandels haben Forscher:innen des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) analysiert, wie sich extreme Temperaturen und andere Umweltfaktoren auf die Gesundheit auswirken. Besonders heiße und kalte Tage führten in den letzten Jahren zu einem Anstieg notfallbedingter Krankenhauseinweisungen und verursachten so einen Kostenanstieg von jährlich rund 174 Millionen Euro. Eine verringerte Zunahme an Klima- und Gesundheitsschäden hat hingegen die Einführung der CO2-Bepreisung bewirkt. Durch eine signifikante Reduzierung von Emissionen konnten direkt und indirekt mehr als 100 Milliarden Euro möglicher Kosten vermieden werden.
Im Rahmen der Veranstaltung Research Results live „Klima & Gesundheit: Chancen und Her-ausforderungen für Politik & Gesellschaft“ am 26. November 2024 im HCHE stellten Dr. Claudia Konnopka (Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf) und Prof. Dr. Moritz Drupp (Universität Hamburg) ihre Forschungsergebnisse vor und diskutierten das Thema mit dem niedersächsischen Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi und der Landesgeschäftsführerin der Barmer Hamburg, Dr. Susanne Klein, die kurzfristig für den erkrankten Martin Kaiser (Greenpeace Deutschland) an der Podiumsdiskussion teilnahm.
„Besonders die vulnerablen Gruppen sind durch Klimaphänomene gefährdet. Hier müssen wir ansetzen“, unterstreicht Dr. Andreas Philippi, Niedersächsischer Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, und betont, dass Niedersachsen bereits eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht hat: „Die ‚Niedersächsische Strategie zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels‘ wird alle 5 Jahre fortgeschrieben. Seit 2022 gibt es die Koordinierungsstelle für Klima und Gesundheit im Niedersächsischen Landesgesundheitsamt und erst vor wenigen Monaten hat sich das ‚Niedersächsische Aktionsforum Gesundheit und Klima (NAGuK)‘ gegründet. Das Land stellt zudem rund 500 Millionen Euro für Investitionen in die Krankenhausinfrastruktur bereit.“
Wie Hitze und Kälte die stationäre Notfallversorgung beeinflussen
Dr. Claudia Konnopka vom UKE konnte gemeinsam mit ihrem Team herausfinden, dass es zwischen 2010 und 2019 aufgrund hitze- und kältebezogener Effekte an Tagen mit Extremtemperaturen einen Anstieg an notfallbedingten Krankenhausaufnahmen gab. Im Vergleich zu Tagen mit moderaten Temperaturen wurden an den 5 % der heißesten Tage pro Jahr etwa 25.000 Menschen mehr stationär aufgenommen, bzw. an den 5 % der kältesten Tage pro Jahr etwa 22.000. Daraus errechnet sich ein Anstieg der Kosten von rund 174 Millionen Euro pro Jahr allein in der Notfallversorgung. Auch die Mortalität infolge von notfallbedingten Krankenhausaufnahmen war erhöht. Bei extremer Hitze starben jährlich rund 1.300 Personen und bei extremer Kälte rund 3.600 Personen im Krankenhaus. „Unsere Forschungsergebnisse zeigen, dass extreme Temperaturen der Gesundheit schaden und erhebliche Kosten im Gesundheitswesen verursachen. Auf diesen Ergebnissen aufbauend entwickeln wir derzeit ein Instrument, das je nach Wetterlage besonders gefährdete Gruppen wie chronisch Kranke, Ältere, Kinder und Schwangere identifizieren, diese gezielt warnen und geeignete Maßnahmen empfehlen kann“, so Dr. Claudia Konnopka.
Haben CO2-Preise einen positiven Effekt auf die Gesundheit?
Sowohl einen direkten als auch einen indirekten Effekt von CO2-Preisen in Bezug auf Klima- und Gesundheitsschäden haben Prof. Dr. Moritz Drupp von der Universität Hamburg und sein Team feststellen können: Seit der Einführung der Ökosteuer im Jahr 1999, einem Vorläufer der heutigen CO2-Bepreisung, sind die Emissionen in Deutschland signifikant zurückgegangen. Um herauszufinden, ob der Effekt auf die höhere Bepreisung von fossilen Brennstoffen zurückzuführen ist, wurden synthetische Kontrollgruppen anderer EU-Länder erstellt. Das Ergebnis der Studie: „Die Ökosteuer hat von 1999 bis zum Jahr 2009 mehr als 100 Milliarden Euro an sozialen Klima- und Gesundheitsschäden verhindert. Circa zwei Drittel der Effekte der Ökosteuer sind vermiedene Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung“, so Prof. Dr. Moritz Drupp. Direkt führt die CO2-Bepreisung zu einer Abbremsung des Klimawandels und verringert somit Gesundheitsschäden (beispielsweise durch Hitze), vor allem in der Zukunft. Indirekt reduziert sie aber auch unmittelbar die Luftverschmutzung, die aktuell als eine der größten Gefahren für die Bevölkerungsgesundheit gilt.
Bei HCHE Research Results live handelt es sich um eine Veranstaltungsreihe mit dem Ziel, Forschungsergebnisse für die Praxis aufzubereiten und direkt vor Ort auf ihre Praxistauglichkeit zu diskutieren. Das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Rund 90 Wissenschaftler:innen beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung und Organisationen des Gesundheitswesens, Gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, Ambulante und Stationäre Versorgung, KI und Digital Health, Fachkräfte im Gesundheitswesen sowie Bevölkerungsgesundheit.
Für Rückfragen: Hannes Rathjen, Hamburg Center for Health Economics, Tel. 040 42838-9516, hannes.rathjen@uni-hamburg.de
Hohe Corona-Folgekosten durch Belastung von Kindern und Jugendlichen (06.07.2023)
Pressemitteilung der Universität Ulm, 6. Juli 2023
Gemeinsame Expertise der Universität Ulm, des Universitätsklinikums Ulm, des HCHE (Hamburg Center for Health Economics) der Universität Hamburg
Hohe Corona-Folgekosten durch Belastung von Kindern und Jugendlichen
Expertise warnt vor gesamtgesellschaftlichen Kosten psychischer Erkrankungen
Geschlossene Schulen und Sportvereine, Isolation und Einsamkeit: Die zahlreichen psychosozialen Belastungen, denen Kinder und Jugendliche in Deutschland während der COVID-19-Pandemie ausgesetzt waren, haben bei einem Teil der Betroffenen zu emotionalen Störungen oder Verhaltensproblemen bis hin zu psychischen Erkrankungen mit langfristigen Folgen geführt. Für die Gesellschaft bedeutet dies in verschiedenen Bereichen hohe Folgekosten, deren potenzieller Umfang selbst bei konservativer Schätzung im Bereich mehrerer Milliarden Euro pro Jahr liegt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Expertise, die die Universität Ulm in Kooperation mit dem Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg im Auftrag des Bundesministeriums für Familie und Jugend erstellt hat. Das Papier ist am Donnerstag, 6. Juli, auf einer Pressekonferenz mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Bündnis 90/Die Grünen) vorgestellt worden. „Die Expertise zeigt: Jeder Euro, den wir jetzt in die mentale Gesundheit von jungen Menschen investieren, ist gut investiert. Damit tragen wir dazu bei, erhebliche Folgekosten in der Zukunft zu vermeiden und nachfolgende Generationen auch finanziell zu entlasten“, so Paus.
Die Autorinnen und Autoren der Expertise haben berechnet, welche Folgekosten die drei Krankheitsbilder Depression, Angststörung und Essstörung bei Kindern und Jugendlichen auslösen: durch zusätzliche Gesundheitskosten sowie Kosten durch spätere Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit. Die Basis für diese Analysen bildeten systematische Studienauswertungen zu psychosozialen Belastungen, Kindeswohlgefährdung und Kostenfolgen im Kontext der Pandemie. Die Herausforderung dabei war, dass entsprechende Daten noch nicht oder nicht in ausreichender Menge und Qualität vorliegen. Gleichzeitig sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dringenden Handlungsbedarf: „Im Sinne einer ausgleichenden Generationengerechtigkeit sollten langanhaltende Belastungen, die durch diese Krankheitsbilder entstehen, möglichst frühzeitig vermieden werden“, so Professor Andreas Jud von der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm. Zwar gebe es bei Prognosen stets Unwägbarkeiten, doch man könne nicht auf präzise Zahlen warten, die erst in 10 oder 20 Jahren vorliegen werden: „Dann ist es zu spät, zu handeln.“
Die Modellierung zeigt eine Bandbreite mit unterer und oberer Grenze der gesamtgesellschaftlichen Folgekosten:
· 32,3 Millionen Euro Gesundheitskosten Kinder und Jugendlicher bei der Annahme, dass 25 Prozent der zusätzlichen Neuerkrankungen pandemiebedingt in den Jahren 2020 und 2021 aufgetreten sind (100 Prozent der Neuerkrankungen: 129,3 Millionen Euro)
· 161,7 Millionen Euro Gesundheitskosten im Erwachsenenalter pro Jahr bei gleichbleibender Transitionsrate (Anteil derjenigen, die im Erwachsenenalter weiterhin unter dem Krankheitsbild aus der Kindheit/Jugend leiden) wie vor der Pandemie (30 Prozent höhere Transitionsrate: 328 Millionen Euro)
· 2,1 bis 4,1 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitsunfähigkeit im Erwachsenenalter pro Jahr durch den Ausfall an Bruttowertschöpfung
· 553,1 Millionen bis 1,2 Milliarden Euro Kosten durch Arbeitslosigkeit im Erwachsenenalter aufgrund der drei ausgewählten psychischen Krankheitsbilder
Die Gesundheitskosten berechnet hat Professorin Eva-Maria Wild vom HCHE. „Wir haben das vorhandene Datenmaterial nach wissenschaftlichen Standards bestmöglich genutzt, um Schätzwerte zu den Gesamtkosten zu prognostizieren und damit einen Entwicklungskorridor zu beschreiben“, betont Wild. Die Autorinnen und Autoren der Expertise unterstreichen das Ergebnis, dass in Deutschland eine deutliche Verbesserung der Datenbasis notwendig ist – auch für zukünftige Herausforderungen.
Die Expertinnen und Experten leiten aus den erwarteten, hohen Folgekosten drei Handlungsansätze ab. Erstens: Infrastrukturen in den Bereichen Gesundheit und Soziales stärken und besser vernetzen, um psychosoziale Probleme zu erkennen. Zweitens: mehr vorsorgende Untersuchungen bei Jugendlichen zur Früherkennung. Drittens: Ausbau der Intervention, also rechtzeitige therapeutische Hilfe zur Verbesserung der psychischen Gesundheit. In ihrem Fazit weisen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler außerdem darauf hin, dass die psychosozialen Belastungen in der Pandemie vor allem jene Kinder und Jugendlichen und ihre Familien trafen, die bereits zuvor belastet waren. „Bestehende Ungleichheiten wurden noch verstärkt“, sagt Professor Jörg M. Fegert, Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm. Fegert macht sich für die Einführung einer Kindergrundsicherung stark. „Sie kann benachteiligte Familien soweit unterstützen, dass sie überhaupt erst die Ressourcen besitzen, für ihre Kinder bei psychischen Störungen Hilfe in Anspruch zu nehmen.“
So wurden die Folgekosten berechnet
Die Berechnung der gesamtgesellschaftlichen Folgekosten stützt sich auf verschiedene Datenquellen: Die Gesundheitskosten im Kindes- und Jugendalter wurden auf Basis von Kostendaten DAK-Versicherter geschätzt. Da bislang Daten dazu fehlen, ob und wie sich die Transitionsraten im Kontext der COVID-19-Pandemie verändert haben, wurde für die untere Grenze der Gesundheitskosten im Erwachsenenalter von gleichbleibenden Transitionsraten ausgegangen; diese wurden kombiniert mit den Kostendaten GWQ-Versicherter ab 18 Jahren für die drei ausgewählten Krankheitsbilder. Die Schätzung für die jährlichen pandemiebedingten Kosten durch Arbeitsunfähigkeit im Erwachsenenalter beruhen auf Basis der Transitionsraten und Schätzungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Grundlage für die Berechnung der jährlichen Kosten durch Arbeitslosigkeit im Erwachsenenalter waren wiederum die angenommenen Transitionsdaten sowie Daten des Instituts für Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen.
Für Rückfragen:
Professor Andreas Jud, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie Ulm, andreas.jud@uniklinik-ulm.de
Professorin Eva-Maria Wild, Hamburg Center for Health Economics, eva.wild@uni-hamburg.de
Link zur Pressemitteilung: https://www.uni-ulm.de/med/fakultaet/med-detailseiten/news-detail/article/hohe-corona-folgekosten-durch-belastung-von-kindern-und-jugendlichen-expertise-warnt-vor-gesamtgesellschaftlichen-kosten-psychischer-erkrankungen/
Download der Pressemitteilung (pdf)
Text und Medienkontakt:
Christine Liebhardt, Universität Ulm, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, pressestelle@uni-ulm.de
Wie lässt sich die Qualität der Gesundheitsversorgung steigern? (08.05.2023)
Pressedienst der Universität Hamburg, 8. Mai 2023
Millionenförderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
Wie lässt sich die Qualität der Gesundheitsversorgung steigern?
Für die Forschung zur Verbesserung der Qualität in der Gesundheitsversorgung hat das Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg ein umfassendes Programm für Doktorandinnen und Doktoranden ausgearbeitet. Dieses Programm wird jetzt durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit mehr als sechs Millionen Euro für zunächst fünf Jahre gefördert.
„Nachdem in den vergangenen Jahren – nicht zuletzt auch durch die Corona-Pandemie – die Qualität in der Gesundheitsversorgung nicht das zentrale Thema war, wollen wir mit diesem Forschungsprogramm zur Stärkung der Qualität in der Gesundheitsversorgung beitragen“, so Prof. Dr. Tom Stargardt, Leiter des neuen Graduiertenkollegs „Managerial and economic dimensions of health care quality“ beim Hamburg Center for Health Economics (HCHE).
Im Fokus des Forschungsprogramms, das nun von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert wird, stehen dabei die Beziehungen und unterschiedlichen Einflüsse zwischen Leistungserbringern (zum Beispiel Krankenhäusern oder Ärzten und Ärztinnen), Kostenträgern (in der Regel die Krankenkassen) und Patientinnen und Patienten: Welche Anreize für Qualität setzen beispielsweise Krankenkassen in Verträgen mit Krankenhäusern oder Arztpraxen? Wie wirkt der Patient oder die Patientin durch das eigene Verhalten bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen selbst auf die Qualität der Gesundheitsversorgung ein? Welche Rolle spielen Angebote der Krankenkassen? Und wie wirken sich Kooperationen auf die Versorgungsqualität aus?
Ziel des Forschungsprogramms ist es, im Rahmen von Promotionen umfangreich und systematisch zu untersuchen, wie sich Veränderungen, zum Beispiel durch ökonomische Anreize, auf die Qualität der Versorgung auswirken. Dabei kommen sowohl große Datensätze als auch neue Methoden zum Einsatz. Anwendungsbereiche sind unter anderem präventive und kurative Dienstleistungen, Notfallmaßnahmen, Diagnostik, Langzeitpflege und durch die Covid-19-Pandemie ausgelöste Veränderungen.
Universitätspräsident Prof. Dr. Hauke Heekeren: „Ich gratuliere den Kolleginnen und Kollegen des HCHE ganz herzlich zu dieser Bewilligung. Das neue Graduiertenkolleg wird den wichtigen Bereich der strukturierten Nachwuchsförderung mit dem Zukunftsthema Gesundheitsversorgung und deren Finanzierung verbinden. Damit wird das Programm in der Universität Hamburg vor allem eine wichtige Rolle im Potenzialbereich der Gesundheitsökonomie spielen. Hier sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des HCHE maßgeblich an zahlreichen Projekten und Vorhaben beteiligt.“
Junges Forschungsteam sucht neue Wege für eine bessere Gesundheitsversorgung
Ab Oktober 2023 werden die ersten zwölf neuen Promotionsstellen geschaffen und durch ein erfahrenes, interdisziplinäres Team aus Professorinnen und Professoren der Wirtschaftswissenschaften und der Medizin betreut. Das Graduiertenkolleg ist so angelegt, dass in der ersten Förderphase über fünf Jahre insgesamt 24 Promovierende ausgebildet werden.
Die Doktorandinnen und Doktoranden erhalten für ihre Forschungsaufgaben ein umfassendes Qualifizierungsprogramm, bestehend aus vielfältigen Kursangeboten in unterschiedlichen Fachdisziplinen. Die Teilnahme an gesundheitsökonomischen Konferenzen, Workshops und Auslandsaufenthalten vervollständigt die wissenschaftliche Ausbildung. „Mit diesem Graduiertenkolleg wird nicht nur exzellente Forschung erzielt werden, sondern auch dringend erforderlicher Nachwuchs in dem Bereich ausgebildet“, erklärt Tom Stargardt.
Über das HCHE
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mit mehr als 70 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zählt es zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Die Forschenden beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung des Gesundheitswesens, gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, ambulante und stationäre Versorgung, Big Data und Digital Health sowie Bevölkerungsgesundheit.
Mehr Informationen zum Graduiertenkolleg „Managerial and economic dimensions of health care quality“ (2023–2028) unter: https://www.hche.uni-hamburg.de/en/graduiertenkolleg.html
Für Rückfragen:
Prof. Dr. Tom Stargardt
Universität Hamburg
Hamburg Center for Health Economics
E-Mail: tom.stargardt@uni-hamburg.de
Link zur Pressemitteilung: https://www.uni-hamburg.de/20750215/pm22-5791e1b9ad448e9020614a61ac508811feacacde
Mit freundlichen Grüßen
--------------------------------------------
Universität Hamburg
Abteilung Kommunikation und Marketing
Referat Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
Mittelweg 177
20148 Hamburg
Tel: +49 40 42838-2968
E-Mail: medien@uni-hamburg.de
Internet: www.uni-hamburg.de
Sie möchten keine Pressemitteilung der Universität Hamburg mehr erhalten? Dann schicken Sie uns bitte eine Mail an medien@uni-hamburg.de mit dem Betreff „Unsubscribe“.
Impressum
Mehrheit gegen Lockerungen der Corona-Regeln (12.12.2022)
Ob Maskenpflicht in Bus und Bahn, Isolationsvorschriften für Infizierte, Schutzmaßnahmen für Kliniken oder eine Impfpflicht für medizinisches Personal: Die Mehrheit der Menschen in Deutschland findet diese Regeln laut einer Befragung im Rahmen der European COvid Survey (ECOS) richtig. Mehr als jeder Dritte rechnet zudem mit einer weiteren Pandemie innerhalb der nächsten fünf Jahre und nur 26 Prozent meinen, dass Deutschland darauf gut oder sehr gut vorbereitet ist.
Weiterhin zeigen die repräsentativen Umfragen vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg, die in Deutschland und sieben weiteren europäischen Ländern durchgeführt wurde, folgende Ergebnisse:
63 Prozent der Befragten in Deutschland wünschen sich eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur 17 Prozent sprechen sich dagegen aus. Für die Beibehaltung der Isolationspflicht bei einer Infektion votierten 68 Prozent, lediglich 12 Prozent sind für eine Aufhebung. Auch die Schutzmaßnahmen für Kliniken finden große Zustimmung: So unterstützen 70 Prozent die Maskenpflicht für Patientinnen und Patienten sowie Besucherinnen und Besucher und immerhin noch 58 Prozent eine Impfpflicht für medizinisches Personal. Grundsätzlich zeigt sich, dass die Zustimmung zu den Maßnahmen im Westen Deutschlands jeweils am höchsten, im Osten am geringsten ist.
„Auch wenn die Aufmerksamkeit der Bevölkerung mittlerweile eher auf anderen Krisen wie den hohen Energiekosten oder der Inflation liegt, gibt es in Verbindung mit Corona noch verbreitete Ängste vor neuen Mutationen und einer weiteren Pandemie“, erklärt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE, die hohen Zustimmungswerte zu den Maßnahmen.
Obwohl bereits 75 Prozent der Befragten in Deutschland angaben, mindestens drei Impfungen gegen COVID-19 erhalten zu haben und die Krankheitsverläufe insgesamt milder verlaufen, beunruhigt Corona in unterschiedlichem Maße immer noch 80 Prozent der Menschen hierzulande. 16 Prozent gaben dabei an, sehr besorgt zu sein. Unter den befragten europäischen Ländern nehmen diese Sorgen von Norden (Dänemark) nach Süden (Frankreich, Italien, Portugal) zu. Eine mindestens dreifache Impfung führe jedoch nicht grundsätzlich zu mehr gefühlter Sicherheit: Neben Deutschland erzielt auch Italien mit 75 Prozent einen Spitzenwert bei der Dreifachimpfquote, dagegen sind in den Niederlanden trotz geringer Quote von 60 Prozent eher weniger Menschen beunruhigt.
Trotz weit verbreiteter Sorgen in der Bevölkerung nahmen in allen Ländern schützende Verhaltensweisen, wie Abstands- und Hygieneregeln, weiter ab. In Deutschland vermeidet beispielsweise nur noch jeder Dritte Umarmungen, Küsse und Händeschütteln zur Begrüßung und lediglich 27 Prozent denken an die empfohlenen Abstandsregeln.
Als Folge der Corona-Pandemie äußerten viele Menschen hierzulande zudem, dass sie Schwierigkeiten bei der sozialen Teilhabe haben und unter psychischen Belastungen leiden. 43 Prozent berichteten über weniger Kontakte und Freundschaften, 35 Prozent von mentalen Problemen durch COVID-19. Besonders ausgeprägt ist dies in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen: dort erwähnte jeder Zweite negative Einflüsse sowohl auf die Psyche als auch auf die gesellschaftliche Eingebundenheit.
Und auch die künftigen Aussichten sind laut ECOS wenig optimistisch: 37 Prozent der Befragten in Deutschland erwarten eine weitere Pandemie in den nächsten fünf Jahren und nur jeder Vierte ist davon überzeugt, dass Deutschland darauf gut oder sehr gut vorbereitet ist.
Eine Darstellung der Ergebnisse aus allen Befragungswellen ist hier zu finden.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 Menschen in Europa zu ihren die Einstellungen und Sorgen über den Verlauf der Pandemie befragt. Mittlerweile findet die Befragung in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien statt. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen. Circa die Hälfte der Befragten nahm bereits mehrfach teil. Ein Teil der Fragen bleibt immer gleich und bildet somit über den Zeitverlauf die Veränderung ab. Darüber hinaus kommen auch neue Fragen hinzu, die das aktuelle Geschehen aufgreifen.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg (mit Mitteln der Exzellenzstrategie) und erhält eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Gemeinsames Konzept zur sektorengleichen Vergütung soll Gesundheitswesen bedarfsgerechter und effizienter machen (20.09.2022)
Ein Konsortium bestehend aus dem Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg, der Technischen Universität Berlin (TU Berlin), dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi), dem Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) und dem BKK Dachverband hat gemeinsam ein Konzept zur Stärkung der sektorengleichen Versorgung in Deutschland erarbeitet. Ziel ist es, sektorengleiche Leistungen, also solche, die sowohl ambulant als auch stationär erbringbar sind, unabhängig vom Ort der Behandlung gleich zu vergüten.
Deutschland gilt als eines der OECD-Länder einer vergleichsweise geringen Ambulantisierung. „Der Handlungsdruck, die Sektorengrenzen zu überwinden, hat aber auch hierzulande nicht nur vor dem Hintergrund von Personalengpässen immer mehr zugenommen. Mit dem vorgestellten Konzept kann das deutsche Gesundheitssystem bedarfsgerechter und effizienter ausgerichtet werden“, erklärt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor vom HCHE.
Für die Umsetzung sieht das Konzept zwei Phasen vor: Ausgehend vom bereits bestehenden Katalog ambulant erbringbarer Prozeduren (AOP-Katalog) soll in der ersten Phase zunächst eine pragmatische Orientierung an den bestehenden stationären Fallpauschalen den schnellen Aufbau sektorengleicher Strukturen ermöglichen. Dabei werden sektorengleiche Leistungsgruppen (SLG) auf Basis des bestehenden Kostenrahmens des Instituts für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), abzüglich der ausschließlich stationär anfallenden Kosten, kalkuliert und über sektorengleiche Pauschalen (SP) vergütet. Dies führt zwar wegen typischerweise höherer Kosten im Krankenhaus zu einer temporären Überfinanzierung, dient jedoch dem initialen Anreiz, sektorengleiche Strukturen schnell zu etablieren. Geplant ist zudem, innerhalb einer gesetzlich festgelegten Übergangszeit von etwa drei Jahren eine gemeinsame sektorengleiche Datengrundlage zu schaffen, um sektorengleiche Leistungen zukünftig sektorenübergreifend transparent kalkulieren und bewerten zu können.
In der zweiten Phase werden basierend auf einer einheitlichen Leistungsdefinition nach dem Baukastenprinzip flexibel zusammensetzbare sektorengleiche Leistungsgruppen (SLG) gebildet und über sektorengleiche Pauschalen (SP) vergütet.
Die Vergütung erfolgt sowohl in der ersten als auch der zweiten Umsetzungsphase unabhängig vom Ort der Behandlung, aber in Abhängigkeit der medizinischen Komplexität des Falls in zwei Stufen.
Dieses Vergütungskonzept für sektorengleiche Leistungen ist im Rahmen des durch den Innovationsfonds geförderten Projektes „Einheitliche, sektorengleiche Vergütung (ESV)“ entwickelt worden und basiert auf dem 2018 vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen (SVR Gesundheit) vorgeschlagenen Ansatz. Als Vorarbeiten für das heute vorgestellte Konzept ist ein internationaler Vergleich vorgenommen worden. Zudem sind deutsche Abrechnungsdaten analysiert und Leistungserbringer und Krankenkassen befragt worden. Leistungserbringer und Krankenkassen befürworten eine stärkere Ambulantisierung der Versorgung. Das Konzept kann hierzu einen Beitrag leisten und als politische Entscheidungsgrundlage dienen.
Sorge vor neuen Mutationen, Impfbereitschaft sinkt leicht (07.06.2022)
Zwei Drittel aller Menschen in Deutschland sorgen sich vor neuen Corona-Mutationen, jeder Fünfte gibt sogar an, große Sorgen zu haben. Unterdessen sind immer weniger Menschen bereit für eine Auffrischungsimpfung, wie die aktuelle Befragung der repräsentativen European COvid Survey (ECOS) vom Mai 2022 zeigt. Sie wird regelmäßig vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg durchgeführt und befragt mehr als 8.000 Menschen in acht Ländern.
„Die Sorge vor einer weiteren Welle in der Bevölkerung ist real und zeigt, dass für viele Menschen die Pandemie noch nicht vorbei ist“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. Dies zeigt sich nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Mehr als 75 Prozent der Menschen in Spanien, Italien und Portugal befürchten neue Mutationen, weniger sorgenvoll sind insbesondere die Menschen in Dänemark (52 Prozent).
Dennoch sank die allgemeine Impfbereitschaft in Deutschland seit Beginn des Jahres von 86 auf nunmehr 83 Prozent. Wesentlich niedriger liegt mit 75 Prozent die Bereitschaft für eine Auffrischungsimpfung. 16 Prozent sind aktuell gegen eine Auffrischung, neun Prozent gaben an, noch unsicher zu sein. Damit liegt Deutschland unter den befragten Ländern zwar im unteren Mittelfeld, aber mit deutlichem Vorsprung vor Frankreich, das mit Abstand auf dem letzten Platz steht. Nur noch 74 Prozent der französischen Bevölkerung sind allgemein impfbereit, für eine Auffrischungsimpfung sprechen sich weniger als 60 Prozent aus.
„Die sinkende Bereitschaft für eine Auffrischungsimpfung könnte im Herbst und Winter mit einer weiteren Corona-Welle wieder für mehr schwere Infektionsfälle sorgen“, sagt Jonas Schreyögg und empfiehlt, rechtzeitig mit geeigneten Kommunikationsmaßnahmen die Unsicheren auf eine Auffrischungsimpfung hin anzusprechen. Eine weitere Zielgruppe wären die 20 Prozent der Impfbereiten, die bisher noch keine Boosterimpfung erhalten haben.
Von den noch Unsicheren äußerten 34 Prozent, dass sie der Sicherheit der Corona-Impfstoffe misstrauen. Für jeden Zweiten sind Impfungen aber prinzipiell wichtig. Darüber hinaus steigt die Bereitschaft, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, mit dem Bildungs- und Informationsgrad. Je mehr sich Menschen über die Pandemie informieren und den Informationen von der Regierung und den Medien vertrauen, umso eher sind sie bereit, sich impfen zu lassen.
Zwei Jahre Pandemie und ihre Auswirkungen
Trotz der Bedenken über den weiteren Verlauf der Pandemie sind die meisten Menschen gesundheitlich gut durch die vergangenen zwei Jahre gekommen. Zwei Drittel der Befragten haben keine Änderungen festgestellt, bei 11 Prozent verbesserte sich sogar die Gesundheit. Allerdings äußern auch 23 Prozent eine Verschlechterung.
Etwas stärker hat die Pandemie die mentale Gesundheit der Befragten belastet. Jeder Dritte berichtet über negative Auswirkungen, Frauen häufiger als Männer. Die größten Folgen hatte die Pandemie auf die soziale Teilhabe. Für fast jeden Zweiten (44 Prozent) war es in den vergangenen zwei Jahren schwieriger, beispielsweise Freundschaften zu pflegen oder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ganz besonders stark ausgeprägt ist dies in der Altersgruppe ab 55 Jahren. Finanziell hatte die Pandemie bei der Mehrheit keine oder sogar positive Auswirkungen (68 Prozent). Die Daten zeigen jedoch auch, dass Corona insbesondere bei Geringverdienern und Frauen zu einer stärkeren finanziellen Belastung geführt hat.
Eine Darstellung der Ergebnisse aus allen Befragungswellen ist unter folgendem Link zu finden.
Hinweis: Die Impfbereitschaft bezieht sich auf die repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung und beinhaltet geimpfte und noch nicht geimpfte Befragte.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 Menschen in Europa zu ihren die Einstellungen und Sorgen über den Verlauf der Pandemie befragt. Mittlerweile findet die Befragung in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Portugal und Spanien statt. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen. Circa die Hälfte der Befragten nahm bereits mehrfach teil. Ein Teil der Fragen bleibt immer gleich und bildet somit über den Zeitverlauf die Veränderung ab. Darüber hinaus kommen auch neue Fragen hinzu, die das aktuelle Geschehen aufgreifen.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg (mit Mitteln der Exzellenzstrategie) und erhält eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Mehrheit für Impfpflicht in Deutschland (17.01.2022)
65 Prozent der Menschen in Deutschland unterstützen eine Impfpflicht gegen COVID-19 für alle Erwachsenen. Für eine Impfpflicht für alle Altersgruppen mit bereits zugelassenem Impfstoff – auch Kinder und Jugendliche – sprechen sich 60 Prozent aus. Das ergab die aktuelle Befragung der repräsentativen European COvid Survey, die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg regelmäßig durchführt.
Eine Impfpflicht nur für einzelne Gruppen, wie medizinisches Personal, den öffentlichen Dienst oder Menschen mit Vorerkrankungen und Ältere, erzielt jeweils rund 70 Prozent Zustimmung. „Die Unterstützung einer Impfpflicht scheint daher eher eine generelle Entscheidung der Menschen zu sein. Für wen diese letztendlich gilt, spielt nur eine untergeordnete Rolle“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. Grundsätzlich zeige sich: Je älter die Menschen sind, umso mehr befürworten sie die Impfpflicht. Zudem ist die Zustimmung im Norden und Westen Deutschlands am größten. Ungefähr jeder Sechste hat sich aber aktuell noch keine eindeutige Meinung für oder gegen eine Impfpflicht gemacht.
Obwohl nur jeder Zweite derzeit mit dem Management der Impfkampagne zufrieden ist, stieg die Impfbereitschaft in Deutschland auf 86 Prozent, vier Prozentpunkte mehr als im September 2021. Im Westen und Süden Deutschlands kletterte die Impfbereitschaft auf 90 Prozent, die östlichen Bundesländer liegen mit 77 Prozent deutlich niedriger. „Geringe Werte bei der Impfbereitschaft finden wir vor allem bei den Menschen, die nur geringes Vertrauen in die Regierung haben“, so Schreyögg. In dieser Gruppe liege die Impfbereitschaft bei nur 65 Prozent.
Von den bereits Geimpften sind 79 Prozent bereit, sich auch boostern zu lassen, am höchsten ist der Wert im Westen Deutschlands mit 84 Prozent. Im Osten ist dagegen mehr als jeder fünfte Geimpfte gegen eine Booster-Impfung. Unter den befragten Eltern gaben 56 Prozent an, ihre Kinder impfen zu lassen, vier Prozentpunkte weniger als im September. Gegen eine Impfung ihrer Kinder sind demnach 27 Prozent. In anderen europäischen Ländern zeigen sich hier große Unterschiede: So gaben in Spanien und Portugal nur sechs beziehungsweise sieben Prozent der Eltern an, ihre Kinder nicht impfen zu lassen, in Frankreich sagten dies 30 Prozent.
Ungeachtet der aktuellen Diskussion über eine mögliche Impfpflicht machen sich 81 Prozent der Befragten in Deutschland Sorgen über eine Spaltung zwischen Geimpften und Ungeimpften. In Dänemark liegt dieser Wert mit 68 Prozent am geringsten unter den befragten acht europäischen Ländern, gefolgt von Großbritannien mit 71 Prozent.
Hinweis: Die Impfbereitschaft bezieht sich auf die repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung und beinhaltet geimpfte und noch nicht geimpfte Befragte.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 rund alle zwei Monate 7.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Portugal befragt. Ziel ist es, die Einstellungen und Sorgen der Menschen in Europa über den Verlauf der Pandemie zu messen. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen. Circa die Hälfte der Befragten nahm bereits mehrfach teil. Ein Teil der Fragen bleibt immer gleich und bildet somit über den Zeitverlauf die Veränderung ab. Darüber hinaus kommen auch neue Fragen hinzu, die das aktuelle Geschehen aufgreifen. Inzwischen sind acht Befragungswellen erfolgt; in der letzten Befragung im Juli kam mit Spanien ein weiteres Land hinzu. Somit erhöhte sich die Zahl der Befragten auf 8.000. Die aktuelle Befragung fand vom 23. Dezember 2021 bis 11. Januar 2022 statt.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg (mit Mitteln der Exzellenzstrategie) und erhält eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
78 Prozent der Geimpften sind bereit für eine Booster-Impfung (03.11.2021)
Auch wenn es noch nicht für alle Erwachsenen eine Empfehlung für eine Auffrischungsimpfung gibt, sind 78 Prozent der vollständig Geimpften in Deutschland bereit für eine weitere Impfdosis gegen Covid-19. Unter den über 65-Jährigen ist die Bereitschaft mit 89 Prozent noch höher. Das ergab die repräsentative Befragung European COvid Survey (ECOS), die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg im September durchgeführt hat. Die Befragten sprechen sich zudem dafür aus, jede zweite Impfdosis an Schwellen- und Entwicklungsländer zu spenden.
Wer zunächst mit der Einmalimpfung von Johnson & Johnson geimpft wurde, ist laut ECOS tendenziell weniger bereit, sich noch einmal gegen Covid-19 impfen zu lassen. Die höchste Bereitschaft zeigen diejenigen, die vollständig mit AstraZeneca geimpft wurden. „Da im Verhältnis die meisten Impfdurchbrüche bei Johnson & Johnson gemeldet werden, wird diese Gruppe der bisher nur einmal Geimpften künftig jedoch stärker in den Fokus der Auffrischungsimpfungen rücken“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
In anderen europäischen Ländern zeigt sich unter vollständig Geimpften eine ähnlich hohe Bereitschaft für die dritte Impfung. Von den acht Ländern der Umfrage ist die Bereitschaft in England und Dänemark mit mehr als 84 Prozent am höchsten, am niedrigsten ist sie mit 67 Prozent in Frankreich. „Aber auch in Portugal, das europaweit die höchste Corona-Impfquote hat, liegt die Bereitschaft für die dritte Impfung nur bei 72 Prozent der vollständig Geimpften“, so Schreyögg.
Impfstoff: behalten oder spenden?
Nachdem monatelang Impfstoff hierzulande knapp war, fehlt er jetzt vor allem in Schwellen- und Entwicklungsländern. Um die Pandemie global zu bekämpfen, sprechen sich die Befragten in Deutschland dafür aus, ungefähr die Hälfte der Impfstoffvorräte an die internationale Initiative Covax (Covid-19 Vaccines Global Access) zu spenden, die andere Hälfte sollte für Auffrischungsimpfungen zur Verfügung stehen. Auch in den anderen Ländern, in denen Menschen befragt wurden, ergibt sich ein vergleichbares Ergebnis. Je jünger die Menschen, umso größer die Spendenbereitschaft.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 rund alle zwei Monate in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Portugal jeweils 1.000 Menschen befragt. Seit Juli 2021 findet die Befragung auch in Spanien statt. Ziel ist es, die Einstellungen und Sorgen der Menschen in Europa über den Verlauf der Pandemie zu messen. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg (mit Mitteln der Exzellenzstrategie) und erhält eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Erwartungsdruck erhöht Widerstand bei Ungeimpften (04.10.2021)
European COvid Survey: Impfbereitschaft in Deutschland steigt auf 82 Prozent
Mit 82 Prozent erreicht die Impfbereitschaft in Deutschland vorerst ihren Höchstwert und legt im Vergleich zu Juli um neun Prozentpunkte zu. Dies entspricht auch der Entwicklung in anderen europäischen Ländern mit Spanien und Portugal an der Spitze (jeweils 90 Prozent Impfbereitschaft). Der Anteil der Nicht-Impfbereiten sinkt in Deutschland um sechs Prozentpunkte auf 13 Prozent. Das ergab die repräsentative Befragung European COvid Survey (ECOS), die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg regelmäßig durchführt. Sie fand vom 7. bis 21. September 2021 in acht europäischen Ländern statt.
Weitere Ergebnisse der Befragung: Wer zurzeit noch nicht geimpft ist, zeigt sich unbeeindruckt von aktuellen Maßnahmen wie 2G oder kostenpflichtigen Tests. Nur maximal vier Prozent der Ungeimpften erwägen dadurch eine Impfung. Bei rund 30 Prozent führt dies sogar zu einer Gegenreaktion: Sie geben an, dass eine Impfung noch unwahrscheinlicher würde.
„Neben der größten Sorge, dass die Impfung gegen Covid-19 möglicherweise nicht sicher genug ist, fühlen sich zwei von drei Ungeimpften durch Politik und Gesellschaft unter Druck gesetzt“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. Zu hoher Erwartungsdruck ist damit einer der Hauptgründe für Menschen, sich nicht impfen zu lassen. Von den aktuell noch Ungeimpften in Deutschland geben nur 12 Prozent an, dass sie impfbereit seien, weitere 22 Prozent sind unsicher. „Waren zunächst mehr Menschen mit geringer Bildung eher nicht überzeugt davon, sich impfen zu lassen, hat sich das inzwischen angeglichen. Auch sehen wir kaum mehr Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Geblieben ist, dass Menschen, die sich viel über die Pandemie informieren und den Informationen aus der Regierung und den Ministerien vertrauen, impfbereiter sind“, so Schreyögg.
Kinder und Jugendliche: Mehr Eltern sind für Impfung
Leichte Zuwächse lassen sich auch bei der Impfbereitschaft von Eltern für ihre Kinder und Jugendlichen feststellen. Nach 53 Prozent im Juni würden jetzt 60 Prozent der Eltern in Deutschland ihre Kinder impfen lassen. Waren im Juni noch 23 Prozent unsicher, sind dies aktuell nur noch 13 Prozent.
„Überraschend ist, dass der Anstieg bei der Impfbereitschaft nach der STIKO-Empfehlung Mitte August so moderat ausgefallen ist“, erklärt Schreyögg. Insgesamt machen sich 81 Prozent der Befragten in Deutschland einige oder große Sorgen um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Schülerinnen und Schüler. Ähnliche Werte werden in anderen europäischen Ländern erreicht, in Portugal, Spanien und Italien sind die Sorgen mit um die 90 Prozent am größten.
Mehrheit stimmt aktuellen Maßnahmen zu
Unter den Befragten in Deutschland ist mit 57 Prozent die Mehrheit für eine 2G-Regelung, also den Zutritt beispielsweise in Restaurants oder Clubs nur noch für Geimpfte oder Genesene. Ebenso sehen das die Menschen in Großbritannien, Spanien und Italien. Die geringste Zustimmung mit 43 Prozent gibt es in Dänemark. Ergänzt man die 2G-Regelung um die Gruppe der PCR-Getesteten wächst die Zustimmung in Deutschland um weitere vier Prozentpunkte auf 61 Prozent.
Dass am 11. Oktober 2021 Schnelltests in Deutschland kostenpflichtig werden, finden 64 Prozent richtig, 24 Prozent lehnen dies ab. Bis auf Dänemark und Frankreich stößt die Bezahlung auch in den anderen befragten europäischen Ländern mehrheitlich auf Zustimmung.
Hinweis: Die Impfbereitschaft bezieht sich auf die repräsentative Stichprobe der Gesamtbevölkerung und beinhaltet geimpfte und noch nicht geimpfte Befragte.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 rund alle zwei Monate 7.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Portugal befragt. Ziel ist es, die Einstellungen und Sorgen der Menschen in Europa über den Verlauf der Pandemie zu messen. Ein Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen. Circa die Hälfte der Befragten nahm bereits mehrfach teil. Ein Teil der Fragen bleibt immer gleich und bildet somit über den Zeitverlauf die Veränderung ab. Darüber hinaus kommen auch neue Fragen hinzu, die das aktuelle Geschehen aufgreifen. Inzwischen sind acht Befragungswellen erfolgt; in der letzten Befragung im Juli kam mit Spanien ein weiteres Land hinzu. Somit erhöhte sich die Zahl der Befragten auf 8.000.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg (mit Mitteln der Exzellenzstrategie) und erhält eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie 2022 in Hamburg (19.08.2021)
19. August 2021
HCHE holt erneut Konferenz in die Hansestadt
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie 2022 in Hamburg
Sowohl thematisch als auch organisatorisch steht die 14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) 2022 im Zeichen von Covid-19: Unter dem Motto „Ökonomik der Pandemie“ werden vom 28. bis 29. März 2022 bis zu 500 Wissenschaftler:innen aktuelle Forschungsarbeiten zur Corona-Pandemie und weiteren gesundheitsökonomischen Feldern diskutieren. Nach 2018 lädt das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg im kommenden Jahr zum zweiten Mal nach Hamburg ein. Geplant wird die 14. Jahrestagung als Präsenzveranstaltung mit der Option auf Wechsel in eine Online-Variante.
"Nach zwei Jahren Corona-Pandemie ist es Zeit, die ökonomischen Aspekte, wie die Finanzierung der Krankenhäuser und -kassen oder die Ausstattung und Versorgung in der Pflege, stärker in den Fokus von Politik und Gesundheitswirtschaft zu rücken“, so Prof. Dr. Mathias Kifmann, HCHE-Kernmitglied und Tagungspräsident der dggö Jahrestagung.
Eröffnet wird die Konferenz von der Zweiten Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin der Freien und Hansestadt Hamburg Katharina Fegebank. Eine Bilanz zu Covid-19 und dem deutschen Gesundheitssystem ziehen anschließend für den Krankenhaussektor Prof. Dr. Jonas Schreyögg (Universität Hamburg), für die Finanzierung der Krankenkassen Prof. Dr. Amelie Wuppermann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg) und mit Blick insbesondere auf Technologie und Digitalisierung Prof. Dr. Carsten Schultz (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel). In den Keynotes stehen Impfstrategien (Prof. Dr. Robert Nuscheler, Universität Augsburg) sowie Erfahrungen und Implikationen für den Krankenhaussektor (Prof. Marisa Miraldo, PhD, Imperial College London) im Mittelpunkte der Vorträge. Darüber hinaus werden während der zwei Veranstaltungstage rund 200 Vorträge gehalten.
Neben der jährlichen Auszeichnung des besten Forschungspapiers für eine gesundheitsökonomische Arbeit wird auf der 14. dggö Jahrestagung zusätzlich ein Preis für eine herausragende Veröffentlichung zur Covid-19-Pandemie ausgelobt. Beide Awards sind mit je 5.000 € dotiert.
Konferenzdaten:
14. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö)
Tagungsmotto „Ökonomik der Pandemie
Ort: Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg oder online
Termine:
Call for Papers: 01. Oktober bis 15. November 2021.
Veranstaltung: 28. und 29. März 2022
Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (dggö)
Die dggö fördert die Wissenschaft, Forschung und wissenschaftliche Politikberatung auf dem Gebiet der Gesundheitsökonomie.
Hamburg Center for Health Economics (HCHE)
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mehr als 70 Wissenschaftler:innen beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems.
Große Sorgen vor weiteren Mutationen und einer 4. Welle im Herbst (08.07.2021)
Europaweite Corona-Studie: Impfbereitschaft steigt
Trotz steigender Impfquoten blicken mehr als 90 Prozent der Menschen beunruhigt auf die Ausbreitung neuer Virus-Mutationen und eine mögliche 4. Welle im Herbst. Das ergab die aktuelle Befragung der European COvid Survey (ECOS) zwischen dem 21. Juni und dem 6. Juli 2021. Gleichwohl lehnt die Mehrheit Impfanreize in Form von Geschenken oder Gutscheinen zur Erreichung einer Herdenimmunität ab. Insgesamt stieg die Impfbereitschaft unter den Erwachsenen in Deutschland aber auf 73 Prozent.
In fast allen befragten europäischen Ländern hat die Impfbereitschaft in den vergangenen Monaten zugelegt. Sie liegt nun zwischen 67 Prozent in Frankreich und 84 Prozent in Dänemark und Großbritannien. „Der Anstieg lässt sich insbesondere durch den Rückgang des Anteils der Unsicheren erklären“, so Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des Hamburg Center für Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg. In Deutschland sank die Zahl der Unentschlossenen seit April 2021 von 17 auf 7 Prozent, die Impfbereitschaft stieg im gleichen Zeitraum von 67 auf 74 Prozent. Innerhalb Deutschlands liegt nur der Osten bei der Impfbereitschaft nicht über der 70-Prozent-Marke und verzeichnet mit fast 25 Prozent beinahe doppelt so viele Ablehnende wie der Norden. Hier stehen nur 14 Prozent einer Impfung skeptisch gegenüber. Impfen lassen wollen sich dagegen 78 Prozent.
Erstmals wurden Eltern befragt, ob sie ihre Kinder gegen Corona impfen lassen wollen. In den Niederlanden und Frankreich erklärt dies nur etwa die Hälfte der Befragten, den größten Zuspruch gibt es von Erziehungsberechtigten in Portugal und Spanien: Hier sprechen sich fast drei von vier Erwachsenen dafür aus, ihre Kinder gegen Corona zu impfen. In Deutschland liegt der Wert bei 53 Prozent. „Grundsätzlich befürworten Eltern eine Impfung für Kinder, um sie vor einer Corona-Infektion zu schützen. Für viele Eltern ist jedoch die derzeitig noch geringe wissenschaftliche Datenlage über mögliche Nebenwirkungen der Hauptgrund, wenn sie zögern,“ so Schreyögg.
Kein Ende in Sicht? Sorgenvoller Blick auf den Herbst
Obwohl die Impfungen zunehmen und die Inzidenzzahlen sinken, machen sich viele Menschen Sorgen wegen der weiteren Entwicklung der Pandemie. „Innerhalb Europas sehen wir ein Nord-Süd-Gefälle“, erklärt Jonas Schreyögg. Insbesondere in Spanien und Portugal ist die Angst vor weiteren Virus-Mutationen groß: 96 beziehungsweise 97 Prozent der Befragten sind beunruhigt. 75 Prozent der portugiesischen Bevölkerung machen sich sogar große oder sehr große Sorgen. In Deutschland liegen diese Werte mit 87 und 51 Prozent deutlich darunter; rund neun von zehn Befragten sind hier beunruhigt. Ein ganz ähnliches Bild ergibt sich bei der Frage nach einer möglichen vierten Welle im Herbst. Nur zehn Prozent machen sich in Deutschland darüber keine Gedanken, 57 Prozent haben dagegen große bis sehr große Sorgen. „Auch hier zeigt sich, dass die Sorgen der Bevölkerung von Dänemark zu den Mittelmeer-Ländern zunehmen“, so Schreyögg.
Mit Geld und Geschenken zur Herdenimmunität?
Können Impfanreize die Herdenimmunität beschleunigen und damit die Sorgen der Menschen reduzieren? „Wir haben hier untersucht, ob Maßnahmen, die beispielsweise in Israel oder den USA bereits eingesetzt werden, auch in Europa Akzeptanz finden würden“, erklärt Schreyögg. Ob Restaurant-Gutschein, Millionen-Lotterie oder 100 Euro für eine Impfung – 54 Prozent aller Befragten lehnen Impfanreize zur Erreichung der Herdenimmunität generell ab, weitere 27 Prozent sind unentschlossen. „Die unterschiedlichen Angebote erzielen alle in etwa die gleichen Ergebnisse, was eher auf eine grundsätzliche Ablehnung gegenüber Anreizen hindeutet,“ erläutert Schreyögg. In Deutschland beispielsweise sprechen sich lediglich 24 Prozent für einen Geldbetrag, 21 Prozent für einen Essens-Gutschein und nur je 20 Prozent für eine Lotterie oder ein Stipendium für den Besuch einer Universität aus.
Maske bleibt, Flugreisen und Händeschütteln werden weniger
Auch Fragen zu geänderten Verhaltensweisen und den Corona-Regeln waren wieder Teil der Befragung. Während viele während der Pandemie unbeliebt blieben, könnten sich einige als nachhaltig erweisen. So planen zwar nur 16 Prozent aller Befragten, künftig ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, weitere 30 Prozent erwägen es aber zumindest zeitweise. Gut die Hälfte der Befragten erklärt zudem, auch künftig Masken zumindest während der Grippesaison zu tragen, Flugreisen überwiegend zu vermeiden und auf größere Menschenansammlungen zu verzichten. Und auch das Händeschütteln und andere Begrüßungen wie Umarmungen oder Küsse scheinen bald aus der Mode zu sein: Jede und jeder Zweite will dies in Zukunft unterlassen.
Über die European COvid Survey (ECOS)
Für die European COvid Survey (ECOS) werden seit April 2020 rund alle zwei Monate 7.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Portugal befragt. Ziel ist es, die Einstellungen und Sorgen der Menschen in Europa über den Verlauf der Pandemie zu messen. Einen Schwerpunkt bildet dabei das Thema Impfen. Circa die Hälfte der Befragten nahm bereits mehrfach teil. Ein Teil der Fragen bleibt immer gleich und bildet somit über den Zeitverlauf die Veränderung ab. Darüber hinaus kommen auch neue Fragen hinzu, die das aktuelle Geschehen aufgreifen. Inzwischen sind sieben Befragungswellen erfolgt; in der aktuellen Befragung kam mit Spanien ein weiteres Land hinzu. Somit erhöhte sich die Zahl der Befragten auf 8.000.
Kooperationspartner:
ECOS ist ein gemeinsames Projekt der Nova School of Business and Economics (Portugal), der Bocconi University (Italien), der Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und der Universität Hamburg. Die Universität Hamburg fördert ECOS aus Mitteln der Exzellenzstrategie. Das Projekt erhält zudem eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Mehr als die Hälfte der Deutschen ist für Aufhebung der Impfpriorisierung (22.04.2021)
COVID-19-Studie: Unzufriedenheit mit Corona-Management wächst
Nachdem die Bevölkerung in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie vor gut einem Jahr bisher überwiegend hinter den Eindämmungsmaßnahmen stand, zeigt sich nun eine Trendumkehr. In einer repräsentativen Befragung des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg ist fast jede oder jeder Zweite mit den Maßnahmen und deren Umsetzung nicht einverstanden. Zudem gaben mehr als 40 Prozent der Menschen an, dass das Corona-Management Einfluss auf ihre Wahlentscheidung nehmen wird. 57 Prozent sprechen sich außerdem dafür aus, die derzeitige Impfpriorisierung fallen zu lassen.
Die Menschen in Deutschland äußern sich zunehmend kritischer über das aktuelle Corona-Management: 59 Prozent finden die Maßnahmen ineffektiv und 49 Prozent sind hierzulande mit dem Corona-Management in diesem Jahr nicht einverstanden. Damit liegt Deutschland mit Frankreich gleichauf auf dem letzten Platz unter den befragten sieben europäischen Ländern. Gute Werte für ihr Corona-Management bekommen die Regierungen von Großbritannien, Dänemark und Portugal von ihrer Bevölkerung.
Befragt nach dem aktuellen Impfmanagement zeigen sich 58 Prozent der Menschen in Deutschland nicht damit einverstanden und fast jeder oder jede Zweite findet die Entscheidung, den Impfstoff zentral über die EU zu bestellen, nicht richtig. Eindeutig für die zentrale Bestellung über die EU sprechen sich hingegen beispielsweise die Menschen in Dänemark und Portugal aus.
Für die Erhebung, die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg rund alle zwei Monate durchführt, werden jeweils mehr als 7.000 Menschen in sieben europäischen Ländern befragt. Die aktuelle Befragung fand vom 2. bis 16. April 2021 statt.
Impfbereitschaft wächst, Biontech bei Impfpräferenz vorn
In fast allen untersuchten europäischen Ländern legte die Impfbereitschaft seit Januar dieses Jahres zu. Zwar nimmt Deutschland vor Frankreich noch immer den vorletzten Platz ein, die Impfbereitschaft stieg jedoch von 62 auf 67 Prozent. „In Deutschland sehen wir eine wachsende Bereitschaft zur Impfung insbesondere bei den 25- bis 34-Jährigen, also denjenigen, bei denen die Inzidenz in den vergangenen Wochen besonders hoch war“, sagt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. In dieser Altersgruppe wuchs die Impfbereitschaft seit Januar von 46 auf 60 Prozent. Jede dritte befragte Person in dieser Altersgruppe gab jedoch auch an, kein Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe zu haben.
Während in Deutschland noch fast die Hälfte der Bevölkerung im Januar keine Präferenz für einen Impfstoff hatte, liegt dieser Wert aktuell nur noch bei 26 Prozent. 50 Prozent der Menschen wünschen sich hierzulande eine Impfung mit Biontech/Pfizer, auf Platz zwei liegt mit nur sieben Prozent der Impfstoff von Johnson & Johnson. 29 Prozent lehnen eine Impfung mit AstraZeneca explizit ab. Dagegen haben nur 16 beziehungsweise 15 Prozent der Befragten in Deutschland Vorbehalte gegenüber dem russischen Impfstoff Sputnik V und dem Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm.
Die Mehrheit der europäischen Befragten (55 Prozent) wünscht sich für Geimpfte mehr Freiheiten und begrüßt daher die Einführung eines europäischen Impfpasses. Rund die Hälfte der Menschen spricht sich zudem für eine Aufhebung der Restriktionen beispielsweise bei Reisen, dem Besuch von Restaurants und kulturellen Angeboten aus. In Deutschland liegen diese Werte bei 45 und 42 Prozent und zeigen damit die geringste Zustimmung unter den befragten Ländern.
Vertrauen in Informationen
Die Menschen in Deutschland sind gegenüber den Informationen ihrer Regierung insgesamt skeptischer geworden. So sank das Vertrauen in die Informationspolitik seit Januar 2021 um acht Prozentpunkte. „Diejenigen, die den Informationen nicht vertrauen, lehnen auch eher eine Impfung ab“, erklärt Jonas Schreyögg. Gleiches gelte für Menschen, die sich nur wenig über die Pandemie informieren. Ihre Bereitschaft für eine Impfung liegt bei nur 38 Prozent im Vergleich zu den gut Informierten mit 79 Prozent. Bei den wenig Informierten äußerte auch fast jeder oder jede Zweite Bedenken gegenüber der Sicherheit der Impfstoffe.
Nur geringe Vertrauensverluste gibt es dagegen für Hausärztinnen und Hausärzte sowie Krankenhäuser. Sie genießen nach wie vor ein hohes Ansehen in der Bevölkerung (86 und 84 Prozent). „Insbesondere das große Vertrauen in die Hausärztinnen und Hausärzte könnte im weiteren Verlauf die Impfbereitschaft in Deutschland erhöhen“, erhofft sich Jonas Schreyögg.
Gesundheitskiosk verbessert Versorgung in sozial benachteiligten Stadtteilen Billstedt und Horn (08.04.2021)
Verbesserter Zugang, zufriedenere Akteurinnen und Akteure
Gesundheitskiosk verbessert Versorgung in sozial benachteiligten Stadtteilen Billstedt und Horn
Eine bessere Vernetzung von medizinischer und sozialer Versorgung sowie niedrigschwellige Angebote verbessern nachweislich die Gesundheitsversorgung der Menschen in den Hamburger Stadtteilen Billstedt und Horn. Das zeigt der Abschlussbericht der wissenschaftlichen Begleitevaluation zum Projekt INVEST, den das Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg heute veröffentlicht hat.
Sozial schwache Stadtteile haben oft weniger ambulante Versorgungsangebote – und die vorhandenen Angebote orientieren sich häufig nicht ausreichend an den Bedürfnissen sozial benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Die Folgen sind stark beanspruchte Notaufnahmen sowie eine medizinische Unter- und Fehlversorgung der Menschen.
Mit dem Projekt INVEST („Hamburg Billstedt/Horn als Prototyp für eine Integrierte gesundheitliche Vollversorgung in deprivierten großstädtischen Regionen“), das durch den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses gefördert wurde, startete 2017 in den Hamburger Stadtteilen Billstedt und Horn der Aufbau eines regionalen, integrierten Gesundheitsnetzwerks, das den Fokus auf Prävention, Gesundheitsförderung und -erhaltung richtet. Einen bundesweit einmaligen Schwerpunkt bildet der Gesundheitskiosk, eine niedrigschwellige und unterstützende Stadtteilinstitution, die die Menschen vor Ort in der jeweiligen Muttersprache bei Gesundheits- und Versorgungsfragen berät und schult. Der Gesundheitskiosk bildet eine wichtige organisatorische Schnittstelle zwischen der medizinischen Versorgung und dem Sozialraum.
Das Projekt INVEST wurde durch das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg wissenschaftlich begleitet und aus verschiedenen Perspektiven evaluiert. Die wichtigsten Ergebnisse der Evaluation sind:
Gut besuchter Gesundheitskiosk entlastet Ärztinnen und Ärzte
Mehr als jede und jeder zweite an der neuen Versorgungsform teilnehmende Versicherte (57 Prozent) hat sich während der Projektlaufzeit mindestens einmal im Gesundheitskiosk beraten lassen. Im Durchschnitt wurden dabei drei Beratungen pro Versichertem bzw. Versicherter in Anspruch genommen. Fast die Hälfte davon (40 Prozent) erfolgte zum Thema Übergewicht. Nicht nur die Nutzerinnen und Nutzer sind mit den Angeboten des Gesundheitskiosks sehr zufrieden, auch die am Projekt teilnehmenden Ärztinnen und Ärzte berichten von einer Arbeitserleichterung und einer Verbesserung der Versorgung.
Verbesserter Zugang zu Versorgung und Entlastung der Krankenhäuser
Dass durch das Projekt der Zugang zur ambulanten Versorgung nachweislich verbessert werden konnte, zeigt vor allem ein Blick auf Krankenhausfälle und ambulante Arztbesuche. „Die Menschen gehen mehr in die ambulante Praxis vor Ort und weniger in die Krankenhäuser“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor am HCHE. Am Ende des Projekts konnte ein Rückgang der durch eine effektive ambulante Versorgung vermeidbaren Krankenhausfälle im Vergleich zu den anderen Stadtteilen Hamburgs um fast 19 Prozent festgestellt werden. Zeitgleich ist die Anzahl der Arztbesuche in Billstedt und Horn im Vergleich zu den anderen Stadtteilen Hamburgs um durchschnittlich 1,9 Besuche pro Versichertem bzw. Versicherter und Jahr gestiegen.
„Auf Basis der bisherigen Evaluationsergebnisse empfehlen wir, INVEST in die Regelversorgung zu überführen“, sagt Prof. Dr. Eva Wild, Projektleiterin INVEST am HCHE. Die verbesserte Versorgung und Zufriedenheit von Versicherten und Akteurinnen und Akteuren der Gesundheitsversorgung zeige schon jetzt, dass INVEST ein Vorbild für andere sozial benachteiligte großstädtische Regionen in Deutschland sein könne. „Bei der Bewertung der bisherigen Evaluationsergebnisse ist aber zu berücksichtigen, dass der 18-monatige Evaluationszeitraum, gemessen an der Komplexität des Projektes, sehr kurz ist. Wir empfehlen daher, INVEST weiterhin begleitend zu evaluieren, um die langfristige Wirkungen besser einschätzen zu können.“, so Eva Wild.
Den Evaluationsbericht in Lang- und Kurzform finden Sie hier.
Informationen sind Schlüssel für Impfbereitschaft (08.02.2021)
Corona-Pandemie: Impfbereitschaft und Vertrauen in die Impfstoffe steigt
Seit November 2020 ist die Impfbereitschaft in Deutschland von 57 Prozent auf 62 Prozent leicht gestiegen. 48 Prozent der Menschen, die sich impfen lassen möchten, haben keine Präferenz für einen bestimmten Impfstoff. Eine repräsentative Befragung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg zeigt außerdem, dass sich in Deutschland mehr als 50 Prozent der Bevölkerung gegen eine spätere Zweitimpfung ausspricht, auch wenn dadurch zunächst mehr Erstimpfungen möglich wären.
Im Vergleich mit den anderen befragten Ländern in Europa belegt Deutschland bei der Impfbereitschaft lediglich den vorletzten Platz. Allein Frankreich hat mit 48 Prozent noch weniger Impfwillige. An der Spitze stehen derzeit Großbritannien und Dänemark mit 80 Prozent. Insgesamt legten bei der Impfbereitschaft alle Länder seit November vergangenen Jahres zu. Die repräsentative Befragung des HCHE wird alle zwei Monate bei mehr als 7.000 Menschen in sieben europäischen Ländern durchgeführt.
„Wir sehen, dass vor allem die bisher unentschlossenen jungen Menschen nun eine Entscheidung getroffen haben“, erklärt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Wissenschaftlicher Direktor am HCHE der Universität Hamburg und ergänzt: „Darüber hinaus zeigt sich, dass die Impfbereitschaft steigt, je intensiver sich jemand mit dem aktuellen Geschehen befasst.“ So möchten sich 78 Prozent derjenigen, die die Nachrichten beispielsweise über TV und Zeitungen sehr genau verfolgen, impfen lassen. Im Vergleich dazu sind es nur 42 Prozent der weniger Informierten.
Seit November ist in allen Ländern das Vertrauen in die Sicherheit der Impfstoffe gestiegen, in Großbritannien und Dänemark werden Werte von gut 70 Prozent erreicht. In Deutschland denken immerhin 57 Prozent der Bevölkerung, dass die inzwischen verfügbaren Impfstoffe sicher sind. Auch hier spielt das Interesse eine große Rolle. Im Vergleich aller Länder gilt: Wer gut informiert ist, glaubt mehr als doppelt so oft an die Sicherheit der Impfstoffe als weniger gut informierte Personen (72 zu 32 Prozent).
Wer sich in Deutschland impfen lassen möchte, hat mit 48,2 Prozent keine Präferenz für einen der bislang zugelassenen Impfstoffe. Wenn eine Wahl des Vakzins möglich wäre, würden sich 33,3 Prozent für Biontech/Pfizer entscheiden, 5,8 Prozent für Moderna und nur zwei Prozent für AstraZeneca. Eine Verschiebung der zweiten Impfung, um zunächst mehr Menschen zu versorgen, befürworten hierzulande nur 19 Prozent der Befragten. 51 Prozent lehnen dies ab. In Großbritannien, wo dies bereits umgesetzt wird, stimmen 41 Prozent einer späteren Zweitimpfung zu.
Seit Beginn der Pandemie ist in vielen Länder das Vertrauen in die COVID-19-bezogenen Informationen der Regierung nahezu unverändert. Am höchsten ist es in Dänemark und den Niederlanden mit mehr als 80 Prozent, Deutschland liegt mit 77 Prozent nur knapp dahinter. Eine Ausnahme bildet hier Großbritannien: Ausgehend von hohen Prozentzahlen im April vergangenen Jahres erlitt die dortige Regierung erhebliche Vertrauenseinbußen (84 Prozent im April 2020, 63 Prozent im September und November 2020) und erfährt nun mit 69 Prozent wieder steigende Werte.
Auch wenn aktuell das eigene Risiko, sich mit Corona zu infizieren, ähnlich eingeschätzt wird wie im November, halten sich wieder mehr Menschen an die vorgegebenen Regeln. In allen befragten Ländern sind seit November die Werte für Abstandhalten (in Deutschland von 46 auf 57 Prozent) und das Vermeiden von Umarmungen, Küssen und Händeschütteln zur Begrüßung (in Deutschland von 66 auf 73 Prozent) gestiegen.
Corona-Pandemie: Bevölkerung blickt vorsichtig optimistisch auf die nächsten Monate (24.11.2020)
Auch wenn vielen Menschen in Deutschland die wirtschaftliche Situation des Landes Sorgen bereitet, unterstützen sie mehrheitlich die aktuellen Maßnahmen und sehen für ihre eigene finanzielle und soziale Lage eher optimistisch auf das kommende halbe Jahr. Dies zeigen die neuesten Ergebnisse einer repräsentativen Studie unter Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg, bei der auch nach Weihnachten mit der Familie und der Impfbereitschaft gefragt wurde.
„Die neuen Auswertungen zeigen, dass zwar 64 Prozent aller Befragten (in Deutschland 65 Prozent) hinter den aktuellen Lockdown-Maßnahmen stehen“, sagt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Leiter des HCHE. 46 Prozent der Befragten können sich sogar vorstellen, dass das Leben in den nächsten Monaten wieder wie vor der Corona-Pandemie werden wird. Die weitere wirtschaftliche Entwicklung beurteilen die Menschen hierzulande am besten, allerdings äußern trotzdem noch 51 Prozent Bedenken.
Die persönliche finanzielle Situation der meisten Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hat sich während der Pandemie kaum verändert. Bei 72 Prozent blieb sie nach eigenen Angaben in den vergangenen sechs Monaten konstant, bei fünf Prozent hat sie sich sogar verbessert. Allerdings rechnen 17 Prozent mit einer Verschlechterung im nächsten halben Jahr. Etwas weniger sind es in Dänemark und den Niederlanden. Franzosen und Italiener schätzen ihre eigene finanzielle Lage dagegen deutlich schlechter in der nächsten Zeit ein.
Auch die aktuellen Kontaktbeschränkungen werden in Deutschland als weniger einschneidend wahrgenommen als in anderen Ländern. Circa 60 Prozent erwarten, auch in den kommenden Monaten ausreichend soziale Kontakte zu haben. Das sind fast zehn Prozentpunkte mehr als über alle befragten Länder hinweg. Am meisten leidet die Bevölkerung in Portugal und Italien unter diesen Einschränkungen.
Zusammen mit Frankreich zeigen sich in diesen drei Ländern auch die wenigsten Menschen optimistisch, Weihnachten mit der Familie feiern zu können. Fast doppelt so viele sind es mit 66 Prozent in Dänemark. In Deutschland sagt dies zumindest jeder Zweite. Für die kommenden Monate stellen sich die Menschen überwiegend darauf ein, zu Hause zu bleiben. Insgesamt können sich nur 23 Prozent vorstellen, im nächsten halben Jahr zu verreisen, in Deutschland liegt der Wert mit 26 Prozent leicht höher, gleichauf mit Großbritannien und Frankreich. Menschen in Dänemark, den Niederlanden und Italien zeigen sich weniger reisefreudig.
Bei der Impfbereitschaft konnte der seit April festgestellte Abwärtstrend gestoppt werden. Sie liegt nun wie schon im September bei 57 Prozent. „Nachdem seit Beginn der Pandemie die Impfbereitschaft kontinuierlich gesunken ist, stabilisieren sich die Werte erstmals, allerdings auf einem niedrigen Niveau. Ob auf diese Weise eine Herdenimmunität in der Bevölkerung zu erzielen ist, bleibt ungewiss“, sagt Prof. Dr. Jonas Schreyögg. So liegen beispielsweise die Werte in Dänemark und Großbritannien mit 71 und 69 Prozent wesentlich höher. Auch innerhalb Deutschlands variiert die Impfbereitschaft erheblich: die nördlichen Bundesländer liegen mit 63 Prozent weit vor den westlichen und südlichen Ländern mit 57 und 55 Prozent sowie dem Osten (52 Prozent). Als Grund, sich impfen zu lassen, wird am häufigsten der Wunsch angegeben, sich selbst und Familienmitglieder vor einer Ansteckung zu schützen. Erst an dritter Stelle steht der Wunsch, mit einer Impfung die derzeitigen Corona-Einschränkungen wieder loszuwerden. Diejenigen, die unsicher oder gegen eine Impfung sind, gaben am häufigsten die Sorge vor möglichen Nebenwirkungen an.
Eine Darstellung der Ergebnisse aus allen Befragungswellen ist unter folgendem Link zu finden.
Über die Studie:
Zum vierten Mal befragte die Universität Hamburg zusammen mit Partner-Universitäten mehr als 7.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich zu den Einstellungen, Sorgen und der Impfbereitschaft in der Corona-Pandemie. Die aktuellen Ergebnisse basieren auf dem Befragungszeitraum vom 5. bis 16. November 2020.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt der Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg. Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie.
Simulationen bestärken höheren Schutz für Risikogruppen (20.11.2020)
Forschungsteam simuliert verschiedene Lockdown-Szenarien, um Gesundheit und Wirtschaft zu schützen
Auf Alters- und Risikogruppen abgestimmte Kontaktbeschränkungen können die Sterblichkeit und die wirtschaftlichen Kosten während der Corona-Pandemie geringhalten. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) um Prof. Dr. Martin Spindler. Auf Basis epidemiologischer Daten haben sie die Auswirkungen verschiedener Corona-Maßnahmen im Hinblick auf gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen der Pandemie simuliert.
„Ein gezielter Lockdown, der sich insbesondere auf die Kontakte mit der älteren Bevölkerung bezieht, ermöglicht eine große Verringerung der Mortalität bei gleichzeitig geringen wirtschaftlichen Folgen“, sagt Prof. Dr. Martin Spindler, Mitautor der Studie und Professor für Statistik an der Fakultät für Betriebswirtschaft an der Universität Hamburg. Während so die besonders gefährdeten Personen geschützt werden, können die Einschränkungen für die junge und mittelalte Bevölkerung geringgehalten werden. Auf diese Weise ist der berufliche Alltag nahezu ungefährdet.
Auf ein zu starkes Abschirmen des besonders gefährdeten Personenkreises kann dann verzichtet werden, wenn verschiedene Maßnahmen kombiniert werden. So führen umfangreiche Testungen, effektive Kontaktnachverfolgung (wie beispielsweise durch die Tracing-App), Abstandhalten und eine gut ausgebaute Infrastruktur im Hinblick auf Home-Office-Lösungen zur geringsten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Belastung für Deutschland.
Ein gezielter Schutz von stark gefährdeten Bevölkerungsgruppen kann diesen dabei gleich doppelt zu Gute kommen. Neben dem Schutz vor Ansteckung, können weniger gefährdete Gruppen weiter produktiv tätig sein. Die dadurch entstehenden Gewinne können genutzt werden, um unterstützende Dienstleistungen anzubieten. Denkbar wären unter anderem ein Einkaufsservice oder erhöhte Testkapazitäten für Risikopatienten.
In einem kürzlich veröffentlichten Working Paper zeigt das Team, wie sich die Sterblichkeit und die wirtschaftlichen Kosten unter verschiedenen Lockdown-Maßnahmen entwickeln. Detaillierte Computersimulationen ermöglichen es den Forschenden, die für COVID-19 charakteristischen unterschiedlichen Schweregrade je nach Altersgruppe darzustellen. Die Berücksichtigung von verschiedenen Krankheitsverläufen führt zu sehr exakten Vorhersagen des Pandemieverlaufs unter den potentiellen verhängten Maßnahmen der Regierung.
Mit der zeitgleichen Berücksichtigung ökonomischer Auswirkungen konnte das Team Maßnahmen, die zu gleichen Sterberaten führen, auch wirtschaftlich bewerten. Damit ist es möglich, Politikern und anderen Entscheidungsträgern konkrete, auf realistischen Daten basierende Handlungsempfehlungen im Umgang mit der Corona-Pandemie zur Verfügung zu stellen.
Die Studie steht unter folgendem Link zum Download bereit: https://arxiv.org/abs/2011.01092
Die Sorge der Menschen wächst, die Sorglosigkeit aber auch (28.09.2020)
Während die Sorgen um die eigene Gesundheit mit dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen derzeit wieder größer werden, lässt die Bereitschaft zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln spürbar nach. Dies zeigen die neuesten Zahlen der repräsentativen Befragung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg von mehr als 7.000 Menschen in Deutschland und sechs weiteren europäischen Ländern. In der Umfrage zeigen sich zudem Vorbehalte gegenüber größeren Menschenansammlungen – aber auch gegen das Impfen.
Den Ergebnissen zufolge glaubt in Deutschland fast jeder Vierte, ein hohes Ansteckungsrisiko zu haben. Nachdem dieser Wert zwischen April und Juni gesunken war, bedeutet das seit Juni ein Anstieg um drei Prozentpunkte. Diese Entwicklung zeigt sich in allen befragten Ländern – in Frankreich und Portugal liegen die Zahlen im September sogar deutlich höher als zu Beginn der Pandemie im
April.
Doch trotz dieser wachsenden Sorgen halten sich immer weniger Menschen an Abstands- und Hygieneregeln. So sagen nur noch 45 Prozent der Menschen in Deutschland, dass sie Abstandsregeln beachten. Nur noch 39 Prozent halten sich an die empfohlene Handhygiene. Auch Umarmungen, Küsse und Händeschütteln zur Begrüßung sind wieder auf dem Vormarsch: nur noch 58 Prozent vermeiden diese aktuell, im April waren es noch 77 Prozent. „Wir stellen fest, dass die steigenden Infektionszahlen die Bevölkerung zwar ängstigen, aber gleichzeitig auch, dass eine gewisse Müdigkeit bei der Einhaltung der Regeln zu erkennen ist“, so Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
Zahl der Impfgegner wächst
Auch die Haltung zum Impfen hat sich verändert: Waren im April noch 70 Prozent der Menschen in Deutschland bereit, sich gegen SARS-CoV-2 impfen zu lassen, so sind es aktuell nur noch etwas mehr als die Hälfte. Ein Trend, der sich in allen an der Umfrage beteiligten EU-Ländern zeigt. Insbesondere wächst der Anteil derjenigen, die explizit gegen eine Impfung sind. Die Zahl der Personen, die dagegen unschlüssig sind, ist unverändert.
„Wir konnten feststellen, dass zu den Impfgegnern vor allem Personen gehören, die für sich kein gesundheitliches Risiko durch Corona sehen oder die kein Vertrauen in die Informationspolitik ihrer Regierung oder Organisationen wie der WHO haben“, sagt Schreyögg. „Deshalb ist es wichtig, weitere Anstrengungen zu unternehmen, um das Vertrauen in öffentliche Informationen zu stärken und das Risiko durch Clusterausbrüche künftig zu minimieren.“
Vor leeren Rängen: Fußball, Konzerte & Co.
Obwohl sich viele Menschen mittlerweile zunehmend sorglos verhalten, sind sie sich doch einig in ihrer Skepsis gegenüber größeren Menschenansammlungen. Nur 25 Prozent der Befragten in Deutschland sind der Meinung, dass Fußballspiele wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern stattfinden sollen, 56 Prozent sprechen sich dagegen aus. Nur 15 Prozent würden derzeit in ein Stadion gehen wollen. „In einem Land, in dem jeder Zweite Fußballfan ist, ist das ein erstaunlich niedriger Wert“, so Schreyögg. Ein ähnliches Bild ergibt sich für Musikkonzerte: Nur 24 Prozent der Befragten können sich Pop- und Rockkonzerte mit Zuschauern vorstellen, hingehen würden sogar nur 18 Prozent.
Weniger Befürchtungen haben die Menschen bei Kinos und Theatern. Jeweils 38 Prozent stimmen Vorstellungen mit Zuschauern zu. Hier ist die Bereitschaft hinzugehen zwar etwas größer als bei Stadien und Konzerten, doch mehr als jeder Zweite hält es aktuell für unwahrscheinlich, eine Kino- oder Theater-Vorstellung zu besuchen.
Eine Darstellung der bisherigen Ergebnisse des Projektes ist unter folgendem Link zu finden: https://www.hche.uni-hamburg.de/forschung/corona.html
Über die Studie
Seit April untersucht das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg die Einstellungen, Sorgen und das Vertrauen der Menschen in Bezug auf die Corona-Pandemie. Mehr als 7.000 Befragte in Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich nahmen an jeder Befragungswelle teil. Diese erfolgen online unter repräsentativen Stichproben der Bevölkerung in Bezug auf Region, Geschlecht, Alter und Bildung. Die erste Welle der Feldforschung wurde zwischen dem 2. und 15. April 2020, die zweite zwischen dem 9. und 22. Juni 2020 und die dritte vom 8. bis 19. September 2020 durchgeführt.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt mit den Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien) und Erasmus University Rotterdam (Niederlande). Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie.
28. September 2020
Die Impfbereitschaft sinkt, die Sorge über Nebenwirkungen wächst (13.07.2020)
Im Kampf gegen das Coronavirus gilt ein Impfstoff als entscheidend. Doch würde die Bevölkerung diesen auch nutzen? Während im April 2020 noch 70 Prozent der Menschen in Deutschland bereit waren, sich impfen zu lassen, sank die Zahl im Juni auf 61 Prozent. Viele Menschen sorgen sich insbesondere um mögliche Nebenwirkungen.
In einer repräsentativen Studie unter Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg wurden jeweils im April und Juni 2020 mehr als 7.000 Menschen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich befragt.
Insgesamt sank die Impfbereitschaft gegen das Coronavirus in den befragten Ländern von 74 Prozent im April auf 68 Prozent nur zwei Monate später. Bis auf Portugal verzeichnen alle Länder geringere Zahlen, die größten Abweichungen gibt es in Italien (minus 13 Prozent) und Deutschland (minus 9 Prozent). Deutschland weist zudem – neben Frankreich – die geringste Zustimmung zur Impfung unter den befragten europäischen Ländern auf. Gleichzeitig verdoppelte sich hierzulande die Zahl der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. In Deutschland sagt dies inzwischen jeder Fünfte. „Bedenklich ist, dass zunehmend mehr Menschen eine Impfung gegen das Coronavirus ablehnen, und dies sind weit mehr Menschen als die, die grundsätzlich Impfungen ablehnen“, erklärt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
Mit großem Abstand sorgen sich die meisten Menschen in allen befragten Ländern vor möglichen Nebenwirkungen und um eine nicht ausreichende Wirksamkeit eines möglichen Impfstoffes. 45 Prozent der Menschen, die eine Impfung ablehnen, und 61 Prozent derjenigen, die unsicher sind, nennen dies als die wichtigsten Gründe. Immerhin jeder Siebte, der gegen eine Impfung ist, glaubt nicht, dass das Virus gefährlich für die eigene Gesundheit ist.
Die Studie zeigt allerdings auch, dass Befragte, die von sich selbst sagen, dass sie Informationen von Regierung, Europäischer Union und der Weltgesundheitsorganisation vertrauen, aufgeschlossener gegenüber einer Impfung sind. „Politik und Wissenschaft sollten daher über mögliche Nebenwirkungen sowie die Wirksamkeit eines Impfstoffes sehr transparent kommunizieren und für das Vertrauen der Bürger werben“, empfiehlt Jonas Schreyögg.
Nord-Süd-Gefälle in Deutschland
„Die höchste Zustimmung in allen Ländern finden wir bei Männern, die älter als 55 Jahre sind, und bei denjenigen, die in einem Haushalt mit älteren Menschen oder mit einer Person mit chronischen Vorerkrankungen leben“, so Schreyögg weiter. Frauen sind über alle Altersgruppen hinweg unsicherer, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht. Speziell in Deutschland zeigt sich, dass Familien und Haushalte mit körperlich oder geistig behinderten Menschen die geringste Impfbereitschaft unter allen Haushaltskonstellationen haben.
Zudem verteilt sich die Impfbereitschaft innerhalb Deutschlands unterschiedlich: Die Impfbereitschaft nimmt von Norden (67 Prozent) nach Süden (56 Prozent) ab. In Bayern beispielsweise ist nur jeder Zweite (52 Prozent) bereit, sich impfen zu lassen. Zwischen alten und neuen Bundesländern gibt es dagegen nur geringe Unterschiede (60 bzw. 65 Prozent).
Gerechte Verteilung eines Impfstoffes
Mit der Verfügbarkeit eines Impfstoffs stellt sich zugleich die Verteilungsfrage, schließlich wird nicht für alle impfbereiten Menschen unmittelbar Impfstoff bereitstehen. Wer sollte darüber bestimmen, wer einen Impfstoff gegen das Coronavirus als Erstes erhält? Hier sind sich die Befragten in allen Ländern einig: Sie sprechen die höchste Kompetenz Krankenhäusern und Ärzten (61, in Deutschland 54 Prozent), dem Gesundheitsministerium (55, in Deutschland 47 Prozent) oder einem nationalen Expertenteam (54, in Deutschland 46 Prozent) zu.
Weniger geeignet sind aus Sicht der Befragten die Regierung oder das Parlament. Die Entscheidung darüber dem Pharmaunternehmen zu überlassen, das den Impfstoff auf den Markt bringt, lehnt die Bevölkerung in allen befragten Ländern mehrheitlich ab (über alle Länder 55, in Deutschland 61 Prozent), ebenso wie eine Volksabstimmung (56, in Deutschland 54 Prozent) oder eine Verlosung (67, in Deutschland 71 Prozent).
Eine Darstellung der ersten Ergebnisse des Projektes ist auf der Webseite des HCHE zu finden.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg, der Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien) und Erasmus University Rotterdam (Niederlande). Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie.
13.07.2020
3,9 Millionen an EU-Gelder für Graduiertenkolleg “Improving Quality of Care in Europe” an der Universität Hamburg (24.05.2016)
24. Mai 2016
3.9 Millionen an EU-Gelder für Graduiertenkolleg “Improving Quality of Care in Europe” an der Universität Hamburg.
Das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) hat gemeinsam mit fünf europäischen Partneruniversitäten - University of York, Universidade de Lisboa, University of Southern Denmark, Bocconi University, Erasmus University Rotterdam - und dem global operierenden Medizintechnikhersteller St. Jude Medical Fördermittel der EU in Höhe von 3,9 Millionen Euro für den Aufbau eines europäischen Graduiertenkollegs erhalten. Mit dem Titel “Improving Quality of Care in Europe” sollen unter der Leitung des HCHE Konzepte zur Verbesserung der Qualität im europäischen Gesundheitswesen erforscht werden. Die Fördergelder kommen aus dem Marie Sklodowska Curie-Programm der Europäischen Kommission, die im Rahmen des Programms Horizon 2020 innovative wissenschaftliche Projekte unterstützt.
Die Forschungsergebnisse des Graduiertenkollegs sollen die Qualität und Leistungsfähigkeit der europäischen Gesundheitssysteme verbessern. Die im Kolleg anvisierten Forschungsfelder orientieren sich an den von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) definierten sechs Dimensionen der Qualität im Gesundheitswesen. Der notwendige enge Praxisbezug der Dissertationsprojekte wird durch die aktive Beteiligung der nicht- akademischen Partner wie der nationalen Krankenkassen, Krankenhäuser, Gesundheitsministerien und gesundheitspolitischen Verbände sichergestellt.
Ab Sommer 2017 starten fünfzehn Doktorandinnen und Doktoranden ihre Forschungsprojekte und belegen ein interdisziplinäres, breitgefächertes Ausbildungsprogramm. Das dreijährige Curriculum beinhaltet neben Kernkursen, wie Epidemiologie, Mikroökonomie oder experimentelles Forschungsdesign auch Kurse für berufliche Schlüsselqualifikationen, die das Projektmanagement, Führungs- und Kommunikationsfähigkeit der Doktoranden fördern sollen. Den beteiligten Universitäten bietet das Doktorandenkolleg die Möglichkeit, talentierte Nachwuchswissenschaftler zu fördern und strategisch wichtige Partnerschaften mit anderen Forschungseinrichtungen zu knüpfen.
Von Argwohn bis Zuversicht – Wie die Menschen die aktuelle COVID-19-Lage beurteilen (24.06.2020)
Wie viel Vertrauen haben die Menschen in die neue Normalität? Eine repräsentative Studie unter Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg zeigt: Nur 44,4 Prozent der befragten Menschen in Europa halten die Geschwindigkeit, mit der die Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie aufgehoben wurden, für richtig.
Europaweit gibt es dabei eine Tendenz, dass viele Menschen die Lockerungen der Einschränkungen als zu schnell empfinden. In Deutschland sagen dies immerhin 36 Prozent. Dies ist der zweithöchste Wert unter den befragten europäischen Ländern nach Großbritannien (45 Prozent). Für 14 Prozent der Menschen geht es hierzulande dagegen zu langsam in die Normalität zurück. Nur vier Prozent sind aktuell der Meinung, dass die Einschränkungen gar nicht nötig waren.
Blickt man auf die großen und besonders stark betroffenen Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, zeigt sich, dass in Bayern mit 27 Prozent und Baden-Württemberg mit 32 Prozent weniger Menschen der Meinung sind, dass die Lockerungen zu schnell sind, dagegen liegt Nordrhein-Westfalen mit 41 Prozent über dem Bundesdurchschnitt.
Umsetzung der Schutzmaßnahmen im Alltag
Bei der Frage, ob sich die Menschen in Restaurants, Kirchen und Fitnessstudios sowie bei Friseuren oder beim Arzt gut geschützt fühlen, ergibt sich ein recht einheitliches Bild: die größte Skepsis herrscht bei religiösen Stätten und Fitnessstudios, am wenigsten Sorge bereitet der Arztbesuch, gefolgt von Supermärkten und Friseuren. Auch wenn die Grundtendenz in allen befragten Ländern gleich ist, zeigt sich doch, dass im besonders stark von COVID-19 betroffenen Großbritannien das Vertrauen noch geringer ist als in den anderen Ländern.
In Deutschland glaubt jeder Zweite nicht daran, dass Kirchen (53 Prozent der Befragten haben wenig oder gar kein Vertrauen) und Fitnessstudios (50 Prozent) genügend Infektionsschutz bieten. Dagegen hat nur etwa jeder Vierte Bedenken beim Friseurbesuch. Restaurants und der öffentliche Nahverkehr liegen mit Werten von 38 Prozent und 44 Prozent im Mittelfeld. Mehr Zuversicht herrscht beim Lebensmitteleinzelhandel und im Gesundheitssektor, also in den Bereichen, die von den Schließungen nicht betroffen waren. Sowohl Bäckereien als auch größere Supermärkte haben überwiegend das Vertrauen ihrer Kunden. Nur jeder Vierte befürchtet, dass Hygiene- und Abstandsregelungen nicht entsprechend umgesetzt werden.
Den besten Schutz trauen die Befragten Arztpraxen und Krankenhäusern zu: Nur elf beziehungsweise 12 Prozent der Menschen haben hier wenig oder gar kein Vertrauen. „Die Sorge der Krankenhäuser, dass Notfallpatienten sich aus Angst vor einer COVID-19-Ansteckung nicht behandeln lassen, scheint derzeit unbegründet“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor beim HCHE.
Wirtschaftliche und finanzielle Sorgen nehmen ab
Im Vergleich zu der ersten Befragung im April zeigt sich, dass die Sorgen der Menschen in Deutschland in Bezug auf die finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie inzwischen geringer sind. Die größte Entwicklung entfällt auf das Gesundheitssystem: Nur noch 29 Prozent machen sich aktuell große oder einige Sorgen um eine Überlastung – im April waren es noch mehr als doppelt so viele.
Über die Studie
Die Studie untersucht die Einstellungen, Sorgen und das Selbstvertrauen der Menschen in Bezug auf die COVID-19-Pandemie in einer Online-Umfrage unter repräsentativen Stichproben der Bevölkerung nach Region, Geschlecht, Alter und Bildung in sieben europäischen Ländern (Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich) mit mehr als 7.000 Befragten in jeder Welle. Die erste Welle der Feldforschung wurde zwischen dem 2. und 15. April 2020 und die zweite Welle zwischen dem 9. und 22. Juni 2020 durchgeführt. Etwa 60 Prozent der Befragten der ersten Welle nahmen auch an der zweiten Welle der Umfrage teil; die verbleibende Stichprobe besteht aus neuen Befragten, um auch hier die Repräsentativität der Stichprobe zu gewährleisten.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg mit den Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien) und Erasmus University Rotterdam (Niederlande). Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie.
Eine Darstellung der Ergebnisse dieser Befragungswelle finden Sie hier.
24. Juni 2020
Gleiches Geld für gleiche Leistung? Forschungsprojekt untersucht einheitliche, sektorengleiche Vergütung für ambulant-stationäre Leistungen (11.05.2020)
Medizinische Leistungen wie z.B. Operationen, die sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt werden können, werden bislang je nach Sektor unterschiedlich bezahlt. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass der Patient nicht im für ihn angemessenen Sektor behandelt wird. Wie muss ein einheitliches, übergreifendes Vergütungssystem ausgestaltet sein, damit die in verschiedenen Sektoren gleich erbrachten Leistungen berücksichtigt und Fehlsteuerungen vermieden werden können? Das untersucht jetzt ein vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit 1,1 Millionen Euro gefördertes Projekt.
Unter Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg arbeiten die Technische Universität Berlin (TU Berlin), das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der Bundesrepublik Deutschland (Zi), das Deutsche Krankenhausinstitut (DKI) und der BKK Dachverband gemeinsam am Konzept einer einheitlichen, sektorengleichen Vergütung (ESV). „Hierdurch kann das deutsche Gesundheitssystem bedarfsgerechter ausgerichtet und die Qualität der Leistungserbringung verbessert werden“ erklärt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor vom HCHE. Das Projekt läuft 2,5 Jahre.
Fallpauschalen für die Krankenhäuser, Einzelleistungen für die Praxen: Patienten sollen dort behandelt werden, wo sie die medizinisch sinnvollste Behandlung erfahren. „Wenn finanzielle Anreize entstehen, konkurrieren ökonomische Überlegungen mit dem medizinischen Bedarf des Patienten“, so Ricarda Milstein, wissenschaftliche Mitarbeiterin am HCHE. Doch um welche Leistungen geht es überhaupt? Nur Operationen – oder betrifft es auch weitere Behandlungen und Diagnostik? Sind Patienten, die ambulant und stationär behandelt werden, überhaupt vergleichbar? Wie könnte eine Neustrukturierung der Vergütung aufgebaut werden?
Zur Beantwortung dieser Fragen werden zunächst Erfahrungen aus anderen OECD-Ländern zusammengetragen. Ein Forscherteam der TU Berlin erarbeitet, welche Leistungen in anderen Industrienationen sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt werden und wie diese vergütet werden. Aufbauend darauf werden vom HCHE Versicherungsdaten der Betriebskrankenkassen, vom Zi Abrechnungsdaten von Ärztinnen und Ärzten analysiert. Ziel ist es herauszufinden, wie vergleichbar Patienten sind, die sich entweder ambulant oder stationär behandeln lassen. Eine Befragung bei Leistungserbringern und Krankenkassen, durchgeführt durch das DKI, ermittelt zudem Bedürfnisse und Anforderungen, die diese an das neue Vergütungssystem stellen. Am Ende soll ein Vorschlag zur einheitlichen, sektorengleichen Vergütung stehen, der von Leistungserbringern und Krankenkassen gemeinsam befürwortet wird und als politische Entscheidungsgrundlage dienen kann.
11.05.2020
Befragung in sieben europäischen Ländern: Bevölkerung steht hinter den politischen Entscheidungen zur Eindämmung von COVID-19 (23.04.2020)
Die bisherigen Entscheidungen und Empfehlungen von Politik und Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden von den Bürgerinnen und Bürgern in den sieben europäischen Ländern mehrheitlich unterstützt. Sorgen bestehen vor allem vor einer Überlastung des Gesundheitssystems und den wirtschaftlichen Aussichten, besonders für kleine Geschäfte. Beim Einsatz von Tracking-Apps sind die Deutschen deutlich zurückhaltender als andere.
Was denken die Menschen in Europa über die Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie wie Schulschließungen, Verbote öffentlicher Versammlungen, Grenzschließungen oder Geldstrafen für Quarantäneverstöße? Dazu wurden unter der Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg Anfang April mehr als 7.500 repräsentativ ausgewählte Personen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich befragt. Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie.
„Grundsätzlich zeigt sich in Europa ein einheitliches Bild mit einer breiten Unterstützung der Bevölkerung für die bereits getroffenen politischen Maßnahmen“, sagt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE und einer der Autoren der Studie. Mehr als 60 Prozent der befragten Personen finden die getroffenen Entscheidungen richtig, nur 16 Prozent lehnen diese ab. Besonders hohe Zustimmungswerte gibt es beispielsweise zu den Beschlüssen, öffentliche Veranstaltungen nicht stattfinden zu lassen (mehr als 80 Prozent) sowie Grenzen (mehr als 80 Prozent) und Schulen zu schließen (80 Prozent).
„Interessante Ergebnisse fanden wir bei zwei in den Medien besonders intensiv diskutierten Maßnahmen: zum einen beim Exportverbot für medizinische Geräte, zum anderen bei der Nutzung mobiler Daten“, so Schreyögg. Insbesondere die Befragten in Großbritannien, Frankreich und Italien sprechen sich mehrheitlich für ein Exportverbot für medizinische Ausstattung wie zum Beispiel Mund-Nasen-Masken aus. Etwas geringer ist die explizite Zustimmung (zwischen 40 und 50 Prozent) in Portugal, Deutschland und den Niederlanden. In Dänemark wünscht nur jede dritte Person ausdrücklich ein Ausfuhrverbot.
Mit dem Einsatz von Tracking-Apps und der damit verbundenen Auswertung mobiler Daten zur Identifizierung von Kontaktpersonen von Infizierten ist in Deutschland nur die Hälfte der Befragten einverstanden. Dies ist der geringste Wert im Ländervergleich. In Italien sind 85 Prozent der Befragten grundsätzlich dafür; der höchste Wert unter den europäischen Ländern, gefolgt von Portugal und Großbritannien.
Europaweit machen sich die Menschen vor allem Sorgen über eine Überlastung des Gesundheitssystems. An zweiter Stelle stehen die wirtschaftlichen Auswirkungen, insbesondere für kleine Unternehmen, und eine mögliche Rezession. Die Angst, selbst arbeitslos zu werden, ist in Italien und Portugal am größten, in Deutschland mit am geringsten. In allen Ländern beschäftigt die Befragten, wie sich die Menschen durch die Pandemie möglicherweise verändern: Die Sorge, dass die Gesellschaft egoistischer wird, zeigt sich in allen Alterskategorien und bei allen Geschlechtern.
Die jetzt veröffentlichten Ergebnisse sind Teil einer dreistufigen Befragung. Zwei weitere Untersuchungen werden in vier und acht Wochen folgen. Ziel ist es, herauszufinden, welche Einstellung die Bevölkerung in den untersuchten Ländern zu den getroffenen Maßnahmen und den mit COVID-19 verbundenen Risiken hat und wie sich diese über die Zeit – auch durch die Einführung oder Aufhebung von Maßnahmen – verändern.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt der Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) und des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg.
23.04.2020
Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen, Impfbereitschaft, Falschinformationen: Europaweite Studie zur COVID-19-Pandemie gestartet (03.04.2020)
Wie ist die Einstellung der Menschen in Europa zu COVID-19 und den damit verbundenen Risiken und Präventionsmaßnahmen? Mit dieser Fragestellung ist nun eine repräsentative Befragung von 7.000 Personen in Deutschland, Dänemark, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Portugal und dem Vereinigten Königreich gestartet.
Die Studie steht unter der Leitung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg und ist die bislang einzige Studie, die evidenzbasiert im Längsschnitt die Einstellungen zu sowie die Akzeptanz von Präventionsmaßnahmen in mehreren Ländern Europas untersucht. Die Universität Hamburg fördert das Projekt aus Mitteln der Exzellenzstrategie. Erste Ergebnisse werden bereits um den 17. April 2020 erwartet.
Die Befragung erfolgt online und in drei Wellen: in diesen Tagen, dann wieder in vier und in acht Wochen. „Jede der drei Befragungswellen wird weitere Erkenntnisse darüber bringen, wie die Europäerinnen und Europäer mit der Bedrohung durch das Virus umgehen. Sie wird uns helfen, zu verstehen, wie sich die Risikobereitschaft der Menschen über die Zeit verändert und ob es zu einer Ermüdung kommt, je länger die Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelten“, sagt Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor am HCHE.
Zusätzlich werden Fragen nach einer generellen Impfbereitschaft gestellt sowie nach der Bereitschaft, für eine Impfung zu zahlen. Überprüft werden soll auch, ob es von objektiven (Gesundheitszustand und Alter) und subjektiven Risikofaktoren abhängt, inwieweit Menschen gewillt sind, auf einen Impfstoff zu warten. „Auch hier erwarten wir länderspezifische Unterschiede, schließlich ist jedes Land anders vom Virus betroffen. Außerdem treffen verschiedene Mentalitäten und unterschiedliche Reaktionen auf gesellschaftliche Ausnahmezustände aufeinander“, erklärt Sebastian Neumann, wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Universitäten Hamburg und Rotterdam.
Aktuell arbeiten die Behörden gegen Falschinformationen und Verschwörungstheorien zu COVID-19 an. Solche Fehlinformationen können den Bemühungen der Gesundheitsbehörden, den Ausbruch einzudämmen, entgegenwirken. Daher wird in der Befragung getestet, welche Botschaften zur Prävention und zur Aufklärung am besten geeignet sind. Ziel ist es, herauszufinden, wie sich die Risikowahrnehmung und das Verhalten der Menschen je nach Informationsbereitstellung und -aufbereitung verändern. Schließlich ist es wichtig, Maßnahmen gegen das Coronavirus so zu gestalten, dass die Bereitschaft der Bevölkerung, diesen Folge zu leisten, maximiert wird – auch über einen längeren Zeitraum hinweg.
Die Befragung erfolgt als Kooperationsprojekt der Universitäten Nova School of Business and Economics (Portugal), Bocconi University (Italien), Erasmus University Rotterdam (Niederlande) unter der Leitung des Hamburg Center for Health Economics der Universität Hamburg.
Risky Health Behaviors Workshop: Tagung über ökonomische Folgen und Gründe von ungesunden Lebensweisen (10.09.2019)
10. September 2019
Wenn Rauchen, Trinken oder Übergewicht krank machen:
Internationale Tagung diskutiert über ökonomische Folgen und Gründe von ungesunden Lebensweisen
Am 25. und 26. Oktober 2019 wird das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) zum zweiten Mal Treffpunkt internationaler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um über riskantes Gesundheitsverhalten und deren ökonomische Auswirkungen und Gründe zu diskutieren. Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, Übergewicht, ungeschützter Sex - risikoreiche Lebensweisen haben nicht nur Folgen für die Person, sondern auch einen großen Einfluss auf die Gesellschaft. „Obwohl der Umgang mit riskantem Gesundheitsverhalten eher national geprägt ist, beispielsweise durch Gesetze, die das Rauchen in Restaurants verbieten, können internationale Erfahrungen neue Perspektiven aufzeigen“, so Prof. Thomas Siedler vom HCHE und Initiator des 2. Risky Health Behaviors Workshops.
Mit insgesamt 26 Vorträgen gibt der Risky Health Behaviors Workshop einen breiten Überblick über den aktuellen Stand der Forschung unter anderem in den Themengebieten Rauchen, körperliche (In-)Aktivität, Alkohol und Drogen. Mit Professor Jody L. Sindelar von der Yale University und Professor Christopher Ruhm von der University of Virginia konnten renommierte Keynote Referenten gewonnen werden. Die beiden US-Ökonomen werden insbesondere über die wirtschaftlichen Aspekte bei Drogenmissbrauch und Adipositas berichten sowie der Frage nachgehen, ob Sterblichkeit für die am wenigsten Begünstigten überproportional gestiegen ist. „Wenn ökonomische Untersuchungen zu gesellschaftlichen Veränderungen führen, die letztendlich jedem Einzelnen zugute kommen, können wir die Bevölkerungsgesundheit verbessern“, erklärt Prof. Jan Marcus, Mitinitiator und HCHE-Forscher.
Informationen zur Anmeldung erfolgen über anmeldung@hche.de.
Arbeitslosigkeit erhöht die Rauchwahrscheinlichkeit von Paaren (28.05.2019)
28. Mai 2019
Wenn der Mann arbeitslos wird: Rauchwahrscheinlichkeit für beide Ehepartner steigt
Ein Arbeitsplatzverlust belastet nicht nur die Gesundheit der betroffenen Person, sondern kann auch direkte Auswirkungen auf den Partner haben. Eine Studie vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE) zeigt erstmals, dass die Arbeitslosigkeit eines Partners die Rauchwahrscheinlichkeit beider Lebenspartner um 2 bis 4 Prozentpunkte erhöht. Darüber hinaus steigt auch die Zahl der pro Tag gerauchten Zigaretten um durchschnittlich 8 Prozent für beide Partner. „Rauchen erhöht nachweislich das Risiko von Lungenkrebs und Herzinfarkten. Dass sich die Arbeitslosigkeit einer Person auch auf das Rauchverhalten des Partners auswirkt, erhöht die Tragweite der gesundheitlichen Risiken eines Arbeitsplatzverlustes erheblich“, erklärt Prof. Dr. Jan Marcus, Kernmitglied beim HCHE. Im Detail zeigt sich jedoch, dass Frauen eher mit dem Rauchen anfangen oder mehr rauchen, wenn der Mann arbeitslos wird. Andersherum – also wenn die Frau arbeitslos wird – zeigten sich dagegen keine Effekte beim Partner. „Häufig ist immer noch der Mann Hauptverdiener und somit sind die Auswirkungen eines Jobverlustes beim Mann größer. Diese Vermutung wird ebenfalls durch unsere Analysen gestützt“, erläutert HCHE-Forscher Jakob Everding einen möglichen Grund für den ausschließlich einseitigen Übertragungseffekt.
Bekannt ist bereits, dass die Wahrscheinlichkeit des Rauchens bei eigener Arbeitslosigkeit steigt. Zum ersten Mal standen nun die Effekte auf den Partner bzw. die Partnerin im Mittelpunkt der Untersuchung. Auf der Grundlage des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) in Deutschland wurden Daten verheirateter und unverheirateter Paarbeziehungen etwa ein Jahr vor und nach dem Verlust des Arbeitsplatzes ausgewertet.
Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass vor allem ehemalige und aktuelle Raucher gefährdet sind, die dann erneut anfangen zu rauchen beziehungsweise mehr rauchen. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass Nichtraucherhaushalte auch bei Arbeitslosigkeit eines Partners in der Regel Nichtraucherhaushalte bleiben.
Die Forscher konnten darüber hinaus erstmals einen schützenden Effekt feststellen, einen Nichtraucher als Partner zu haben. Unabhängig davon, welcher der beiden Partner arbeitslos wird, zeigt sich demnach sowohl für aktuelle Raucher als auch für Nichtraucher ein geringeres Rauchverhalten, wenn der Partner bislang nicht geraucht hat.
Auf Basis dieser Ergebnisse empfehlen die Studienautoren, bei präventiven Maßnahmen, wie Aufklärungskampagnen, auch die neu identifizierte Risikogruppe zu adressieren und somit auf gesundheitliche Auswirkungen für den Gesamthaushalt bei drohender Arbeitslosigkeit hinzuweisen.
Originalbeitrag: Jakob Everding und Jan Marcus: The Effect of Unemployment on the Smoking Behavior of Couples; HCHE Research Paper Nr. 17, 2019.
Link: https://www.hche.uni-hamburg.de/dokumente/research-papers/rp17-everding-marcus.pdf
Kosten für Lungenkrebsscreening in Deutschland (14.05.2019)
14. Mai 2019
Gesetzliches Lungenkrebsscreening in Deutschland? Studie ermittelt Kosten und Nutzen einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung für starke Raucher ab 55 Jahren
Lungenkrebs ist die häufigste Ursache für krebsbedingte Todesfälle, Rauchen gilt dabei als Risikofaktor Nummer eins. Während die klinische Studie des National Cancer Institute aus den USA zeigt, dass mit einem jährlichen bevölkerungsbasierten Screening-Programm die Lungenkrebssterblichkeit um 20 Prozent reduziert werden konnte, ist in Deutschland eine gesetzliche Früherkennung bislang nicht vorgesehen. Florian Hofer und Prof. Dr. Tom Stargardt vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE) haben in Kooperation mit Prof. Dr. Hans-Ulrich Kauczor vom Universitätsklinikum Heidelberg mittels eines Modells simuliert, welche Kosten und welcher Nutzen bei Einführung eines Lungenkrebs-Früherkennungsprogramms in Deutschland entstehen würden. Das Ergebnis: Berücksichtigt man nur die starken Raucher (>20 Zigaretten pro Tag über einen Zeitraum von 10 Jahren) zwischen 55 und 75 Jahren liegen die Kosten je gewonnenes Lebensjahr bei 19.302 Euro beziehungsweise bei 30.291 Euro je gewonnenes qualitätsadjustiertes Lebensjahr (QALY). „Dies ist durchaus mit dem Kosten-Effektivitäts- beziehungsweise -Nutz-wertverhältnis anderer Krebsscreenings vergleichbar“, so Tom Stargardt vom HCHE.
Gerechnet über 15 Jahre ergab sich ein zusätzlicher Gewinn von 95.581 Lebensjahren bei Kosten von 1,84 Milliarden Euro für die rund 1,6 Millionen Betroffenen. Die zusätzlichen Ausgaben beinhalten dabei sowohl die zusätzlichen Kosten für ein jährliches Screening mittels niedrig-dosierter Computertomographie (LDCT, 71 %) als auch zusätzliche Kosten für die Behandlung (27 %) und die Nachsorge (2 %) einer wesentlich höheren Anzahl von Diagnosen in einem frühen Stadium.
Bei einer möglichen praktischen Umsetzung sehen die Forscher insbesondere zwei Herausforderungen: die Verfügbarkeit von LDCTs und die ausschließliche Beschränkung auf eine Risikopopulation. Geht man von einer durchschnittlichen Teilnahmequote von 54 Prozent wie bei den anderen Krebs-Vorsorge-Programmen aus, würde dieses Programm zu jährlich ca. 600.000 neuen CT-Untersuchungen führen. Ob die entsprechende Infrastruktur derzeit zur Verfügung steht, muss geprüft werden. Die zweite Herausforderung zielt auf die Tatsache, dass ein derartiges Programm nur auf eine Hochrisikopopulation eingeschränkt wäre.
Originalquelle: Cost-utility analysis of a potential lung cancer screening program for a high-risk population in Germany: A modelling approach von F Hofer, HU Kauczor, T Stargardt; erschienen in Lung Cancer 2018
Betriebliche Fehlzeiten durch Übergewicht sind geschlechterspezifisch (27.11.2018)
27.11.2018
Betriebliche Fehlzeiten durch Übergewicht sind geschlechterspezifisch
Aktuelle Studie zeigt Zusammenhang zwischen Adipositas und Krankheitstagen
Frauen, deren Gewicht sich vom Normalgewicht hin zur Fettleibigkeit erhöht, weisen 27% mehr Fehltage auf als vorher; bei Übergang zum Übergewicht erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für langfristige Fehlzeiten um 40%, während bei Männern in beiden Fällen keine signifikante Veränderung zu beobachten ist.
In Deutschland sind rund die Hälfte aller Frauen und gut 60% aller Männer übergewichtig. Dass Übergewicht nicht nur ein gesundheitliches Risiko darstellt, sondern langfristig auch hohe Gesundheitskosten verursacht, ist bekannt. Wissenschaftler des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) haben jetzt herausgefunden, dass es hierbei Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt.
Dazu haben Dr. Katrin Reber, Prof. Dr. Hans-Helmut König und PD Dr. André Hajek die Daten des deutschen sozioökonomischen Panels hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Übergewicht und Fehlzeiten am Arbeitsplatz ausgewertet. Hierbei handelt es sich um eine Stichprobe von rund 12.000 Haushalten mit etwa 20.000 Personen, die seit 1984 jährlich unter anderem zu soziologischen, psychologischen, ökonomischen und gesundheitlichen Themen befragt werden.
Wenn der BMI die Grenze zum Übergewicht im Laufe des Lebens überschreitet, zeigen Frauen eine Zunahme bei Fehltagen um 27%. Beim Übergang von Normalgewicht zu Fettleibigkeit (Adipositas) erhöhte sich bei Frauen die Wahrscheinlichkeit für langfristige Fehlzeiten von mehr als 6 Wochen um 40%. Bei Männern hingegen sind diese Zusammenhänge nicht feststellbar.
Doch warum fehlen Frauen, die stark zunehmen, häufiger und länger am Arbeitsplatz als Männer? „Eine Rolle dürften psychologische und psychosoziale Faktoren spielen. Übergewicht und Adipositas hängen eng zusammen mit einem negativen Körper- und einem geringen Selbstwertgefühl. Dies ist bei Frauen häufig stärker ausgeprägt als bei Männern“, so das Autorentrio vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Zusätzlich sind übergewichtige und adipöse Frauen häufiger ein Ziel von Diskriminierungen und Vorurteilen, wie Faulheit und mangelnder Selbstdisziplin. Dies führe zu starkem psychischem Druck, der die betroffenen Frauen krank machen kann.
Die Studie zeigt, dass Übergewicht und Fehlzeiten am Arbeitsplatz bei Frauen signifikant miteinander verknüpft sind. „Die Ergebnisse können Ärzte, Krankenkassen und Arbeitgeber helfen, gezieltere Präventionsprogramme aufzusetzen und insbesondere Frauen mit einem erhöhten Risiko frühzeitig Angebote, beispielsweise in den Bereichen Ernährung und Bewegung, zu unterbreiten“, empfiehlt das Autorentrio.
Originalquelle: Reber KC, König HH, Hajek A (2018). Obesity and sickness absence: results from a longitudinal nationally representative sample from Germany, Hamburg Center for Health Ecomomics, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Universität Hamburg, 8:e019839. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-019839
Umfassende Klassifizierung von Notfällen erstellt (12.02.2018)
12. Februar 2018
Umfassende Klassifizierung von Notfällen erstellt
Überfüllte Notaufnahmen, steigende stationäre Aufnahmen, Krankenhäuser in Schieflage. Können Krankenhäuser durch die Separierung von dringenden und nicht-dringenden Fällen entlastet werden? Für eine bessere Steuerung und Planung der Notfallversorgung haben Forscher am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) und der TU Berlin die bisher umfassendste Notfall-kategorisierung in Deutschland vorgenommen. Jeder relevanten Diagnose im ICD-Katalog wurden dabei Dringlichkeitswerte zugewiesen, die sich leicht auf bestehende Krankenhausdaten übertragen lassen. Das Modell basiert auf der Methode des Maschinellen Lernens.
Mit dessen Ergebnissen werden Volumina und Veränderungen in der Elektiv- und Notfallversorgung in Bezug auf Dringlichkeit, Patientenalter und stationäre Krankenhausnutzung bestimmt. Krankenhäuser weisen demzufolge den größten Zuwachs bei den Fällen auf, die weder eindeutige Notfälle noch eine klare elektive Behandlung darstellen; sie haben eine Dringlichkeit zwischen 25 und 75 Prozent. Eine gut planbare Versorgung von Patienten und die sehr dringende Notfallversorgung – also die beiden Enden des Dringlichkeitsspektrums – zeigen die geringsten Wachstumsraten. „In Bezug auf die elektive Versorgung ist das Ergebnis aus wirtschaftlicher Sicht überraschend, da diese für die Planung von Krankenhäusern attraktiv ist“, so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor am HCHE.
Basierend auf dieser neuen Klassifikation lag die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für geplante Aufnahmen in Deutschland von 2005 bis 2013 bei 1,35 Prozent, in diesem Zeitraum stiegen die stationären Notfälle jährlich um 2,56 Prozent. Bisher ging man für diesen Zeitraum von einem jährlichen Anstieg um 4,81 Prozent der Notfälle und einem Rückgang der elektiven Fälle um 0,18 Prozent aus.
Die Dringlichkeitsgrade sind auch auf bestehende Krankenhausdaten in verschiedenen Gesundheitssystemen anwendbar. So lassen sich beispielsweise regionale Unterschiede in der Krankenhausnutzung für die Elektiv- und Notfallversorgung und Ineffizienzen identifizieren. Darüber hinaus können mit der entwickelten Methodik eine künftige Nachfrage nach Notfall- und elektiven Krankenhausbetten sowie erforderliche Bereitschaftskapazitäten vorhergesagt und Krankenhausmanager bei der Fall-Mix-Planung unterstützt werden. Aufgrund der enormen Wachstumsraten in mehreren Ländern liegt eine weitere Anwendung in der Dringlichkeitsschichtung von stationären Fällen, die über die Notaufnahme ins Krankenhaus gelangt sind. „Man könnte das Potenzial für nicht-dringende Einweisungen über die Notaufnahme, die durch den Primärversorgungssektor substituierbar sind, durch die Kombination von Primärversorgungs- und Krankenhausdaten schätzen“, erklärt Prof. Dr. Reinhard Busse von der TU Berlin.
Methode des Machine Learning: Beim Maschinellen Lernen wird ein Computeralgorithmus so lange trainiert bis er in der Lage ist, große Datenmengen nach vorgegebenen Mustern oder Variablen zu klassifizieren. Die Vorhersagen sind sehr genau (in diesem Fall 96 %). Der Einsatz des Maschinellen Lernens im Gesundheitswesen ist neu und diese Studie veranschaulicht das Potenzial für ein breites Spektrum von künftigen Anwendungen im Gesundheitswesen.
Originalquelle: Krämer, J., Schreyögg, J., & Busse, R. (2017). Classification of hospital admissions into emergency and elective care: a machine learning approach. Health care management science, 1-21.
Weniger Arzttermine am Quartalsende - Anstieg beim ärztlichen Bereitschaftsdienst (11.01.2018)
11. Januar 2018
Weniger Arzttermine am Quartalsende - Anstieg beim ärztlichen Bereitschaftsdienst
Wer gegen Ende eines Quartals einen Arzt konsultieren möchte, wartet häufig länger auf einen Termin. Denn Ärzte erbringen zum Quartalsende seltener die Leistungen, die über Pauschalen und Globalbudgets vergütet werden. Vertragsärzte konzentrieren sich dann häufig auf die Leistungen, die keinen mengenbegrenzenden Regelungen unterliegen, zum Beispiel Impfungen, Vorsorge und ambulante Operationen. Zugleich lässt sich ein Anstieg bei den Abrechnungen für den ärztlichen Bereitschaftsdienst beobachten. Das ist das Fazit einer Forschungsarbeit vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE).
„Das ambulante Vergütungssystem führt dazu, dass weniger Behandlungen am Quartalsende stattfinden und es einen sprunghaften Anstieg am Quartalsanfang gibt“, erklärt Prof. Mathias Kifmann vom HCHE. Die Folge: Wer am Quartalsende keinen Termin beim niedergelassenen Arzt bekommt, geht unter Umständen zum ärztlichen Bereitschaftsdienst. Der Anstieg ist drei bis vier Wochen vor Quartalsende mit 19 Prozentpunkten am größten, was sich möglicherweise durch die Verlagerung von Terminen ins nächste Quartal erklären lässt. In den letzten zwei Wochen vor Quartalsende flacht sich der Anstieg ab auf knapp 11 Prozentpunkte. „Wenn Patienten sehr lange auf einen Termin warten müssen, suchen sie offenbar nach Alternativen“, so Prof. Kifmann vom HCHE. Allerdings: Für die Notaufnahmen in Kliniken findet sich kein solcher Effekt.
Größere Arztpraxen oder Praxisgemeinschaften – insbesondere wenn mehrere Fachrichtungen vertreten sind – reagieren weniger stark auf die Auswirkungen der Globalbudgets. „In der Gemeinschaft können Ausfälle oder Schwankungen bei den Leistungserstattungen eher kompensiert werden“, so Prof. Kifmann.
Alle Leistungen der niedergelassenen Ärzte, die durch Globalbudgets vergütet werden – und dies sind je nach Fachrichtung zwischen 50 und 90 Prozent – werden nur solange voll erstattet, bis die so genannten Regelleistungsvolumina oder andere mengenbegrenzende Regelungen auf Arztebene pro Quartal ausgeschöpft sind. Behandeln Ärzte darüber hinaus, erhalten sie nur noch eine geringere Erstattung. Dies führt dazu, dass Leistungen aus dem Globalbudget vielfach in den letzten vier Wochen eines Quartals reduziert werden, und zwar über alle Fachrichtungen hinweg. Der deutlichste Effekt zeigte sich bei Hautärzten, Augenärzten und Gynäkologen.
Für Behandlungen wie Impfungen, Vorsorge und ambulante Operationen, die unabhängig von Pauschalen und Globalbudgets sind, konnten dagegen über alle Fachrichtungen hinweg keine quartalsbedingten Effekte festgestellt werden. Mit einer Ausnahme: Bei Allgemeinmedizinern konnten ähnliche Reduzierungen bei allen Leistungen festgestellt werden. „Wir gehen daher davon aus, dass Hausärzte ihre Praxentätigkeit zum Ende des Quartals einschränken“, erklärt Prof. Kifmann.
Das HCHE kooperierte für die Studie mit dem Wissenschaftlichen Institut der Techniker Krankenkasse (TK) für Nutzen und Effizienz im Gesundheitswesen (WINEG). Die Autoren nutzten Daten der TK, die rund zehn Millionen Menschen in Deutschland versichert. Für die nicht repräsentative Untersuchung werteten sie ambulante Abrechnungsdaten aus den Jahren 2013 und 2014 aus. Untersucht wurden die 30 am häufigsten abgerechneten Gebührenpositionen in den analysierten Fachrichtungen.
Originalquelle: Ambulatory Care at the End of a Billing Period; Konrad Himmel, Udo Schneider, erschienen als HCHE Research Paper Nr. 14 unter https://www.hche.de/forschung/hche-research-papers.html.
Für Rückfragen:
HCHE
Andrea Bükow(andrea.buekow"AT"uni-hamburg.de), Tel.: 040 42838-9515
Call for Papers für die 10. dggö Jahrestagung 2018 in Hamburg (27.09.2017)
27. September 2017
Call for Papers für die 10. dggö Jahrestagung 2018 in Hamburg
Vom 1. Oktober bis 15. November 2017 läuft die Einreichungsfrist für wissenschaftliche Beiträge zur 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö), die vom 5.-6. März 2018 an der Universität Hamburg stattfindet. WissenschaftlerInnen mit aktuellen Forschungsarbeiten in den Themengebieten Gesundheitsökonomie, -politik, -systeme und Versorgungsforschung können sich über die Konferenzwebseite unter www.dggoe.de beteiligen.
Zudem schreibt die dggö den Wissenschaftspreis 2017 für die beste publizierte gesundheitsökonomische Arbeit aus, die im Laufe des Jahres publiziert oder zur Publikation angenommen wurde. Das Themenspektrum umfasst dabei sowohl Arbeiten der Grundlagenforschung als auch Forschung mit einem stärkeren Anwendungsbezug. Der Preis ist mit 5.000 € dotiert und wird während der Jahrestagung verliehen. Einreichungen sind bis zum 31. Dezember 2017 zu richten an: wissenschaftspreis@dggoe.de(wissenschaftspreis"AT"dggoe.de).
Die dggö Jahrestagung ist die größte nationale Konferenz der Gesundheitsökonomen, zu der über 400 WissenschaftlerInnen und VertreterInnen der Gesundheitswirtschaft aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet werden. Präsident der Jubiläumstagung 2018 ist Prof. Dr. Hans-Helmut König, Direktor des Instituts für Gesundheitsökonomie und Versorgungsforschung am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf; ausgerichtet wird die Konferenz 2018 vom Hamburg Center for Health Economics (HCHE). Unter dem Kongressthema „Ökonomie und Medizin im Dialog“ werden deutsche und internationale Referenten über den Beitrag der gesundheitsökonomischen Forschung zur medizinischen Versorgung diskutieren und zudem die Rolle der Gesundheitsökonomie bei der Bewertung medizinischer Technologien durchleuchten. Zudem werden in Parallelsessions über 150 neue Forschungsarbeiten präsentiert, die einen umfassenden Überblick zur aktuellen gesundheitsökonomischen Forschung bieten.
10. dggö Jahrestagung: Jubiläumsveranstaltung 2018 in Hamburg (31.05.2017)
10. dggö Jahrestagung: Jubiläumsveranstaltung 2018 in Hamburg
Die 10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö) findet 2018 in Hamburg statt. Ausrichter der Jubiläumstagung ist das Hamburg Center for Health Economics (HCHE), das nach der EuHEA Conference 2016 bereits die zweite große Konferenz innerhalb von zwei Jahren nach Hamburg holen konnte. „Die dggö Jahrestagung als größte nationale Konferenz der Gesundheitsökonomen fördert den Austausch innerhalb der Wissenschaft und setzt darüber hinaus wichtige Impulse für die künftige Gesundheitsversorgung im deutschsprachigen Raum“, erklärt Prof. Dr. Hans-Helmut König, Tagungspräsident der 10. dggö Jahrestagung und HCHE-Kernmitglied. Zu der Tagung am 5. und 6. März 2018 werden rund 400 Gesundheitsökonomen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz erwartet.
Unter dem Kongressthema „Ökonomie und Medizin im Dialog“ werden deutsche und internationale Referenten über den Beitrag der gesundheitsökonomischen Forschung zur medizinischen Versorgung diskutieren und zudem die Rolle der Gesundheitsökonomie bei der Bewertung medizinischer Technologien durchleuchten. Als Keynote Speaker haben zugesagt: Prof. Dr. Reiner Leidl (Ludwigs-Maximilians-Universität München), Prof. Dr. Ferdinand Gerlach (Johann Wolfgang Goethe Universität in Frankfurt am Main und Vorsitzender des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen), Prof. Dr. Werner Brouwer (Erasmus University Rotterdam) und Prof. Dr. Michael Drummond (University of York). Darüber hinaus werden über 150 neue Forschungspapiere an zwei Konferenztagen in Parallelsessions vorgestellt. Alle Teilnehmer erhalten so einen breiten Überblick in die aktuelle Forschung in den Bereichen Gesundheitsökonomie, -politik, -systeme und Versorgungsforschung.
Übersicht der wichtigsten Informationen zur Konferenz:
10. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (dggö)
Motto „Ökonomie und Medizin im Dialog“
Termin: 5. und 6. März 2018
Ort: Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1, 20146 Hamburg
CALL FOR PAPERS
Themen: Gesundheitsökonomie, Gesundheitspolitik, Gesundheitssysteme, Versorgungsforschung
Termin für die Einreichung von Abstracts: 01. Oktober bis 15.November 2017.
Die eingereichten Beiträge werden einem Peer-Review Verfahren unterzogen.
Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie e.V. (dggö)
Die dggö fördert die Wissenschaft, Forschung und wissenschaftliche Politikberatung auf dem Gebiet der Gesundheitsökonomie. Zu ihren Aufgaben gehören auch die Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben sowie die Vergabe von Preisen und Auszeichnungen. Ziel ist es, gesundheitsökonomische Erkenntnisse zu veröffentlichen und gegenüber Parlamenten und Regierungen zu vertreten.
Hamburg Center for Health Economics (HCHE)
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mehr als 60 Wissenschaftler/innen beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung des Gesundheitswesens, Gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, Krankenhäuser und Ärzte sowie Bevölkerungsgesundheit.
Pflege-Studie: Zuhause gepflegt werden bleibt Bevölkerungspräferenz Nr. 1 (05.04.2017)
5. April 2017
Pflege-Studie: Zuhause gepflegt werden bleibt Bevölkerungspräferenz Nr. 1
Spezialisierte Einrichtungen erhöhen Lebensqualität bei Menschen mit Demenz
Rund 3 Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig; die Hälfte davon ist an Demenz erkrankt. Heutzutage werden zwei von drei Pflegefällen zu Hause betreut, meist durch Angehörige oder Freunde. Dies entspricht auch dem Wunsch der meisten Menschen falls sie zu einem späteren Zeitpunkt Pflegeunterstützung benötigen. Wissenschaftler am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) haben erforscht, wie Menschen im Falle einer Pflegebedürftigkeit leben wollen. Ferner untersuchten sie die Lebensqualität von Menschen mit Demenz, die in einem Pflegeheim leben. In einer Befragung von Angehörigen und Pflegepersonal zeigt sich, dass Bezugspflegepersonen die Lebensqualität der BewohnerInnen mit Demenz signifikant positiver einschätzen als die Angehörigen. Die Lebensqualität der BewohnerInnen mit Demenz ist zudem höher in Einrichtungen, die sich räumlich und personell auf diesen Personenkreis angepasst haben. Aber Pflegeheime können zum Beispiel auch durch die Förderung der Selbständigkeit ihrer Bewohner direkt Einfluss auf die Lebensqualität nehmen. Diese Pflegestudien werden heute im Rahmen der Veranstaltung „HCHE Research Results live“ erstmals vorgestellt. Es sprechen zudem Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks und Martin Sielaff, Geschäftsführer der Hamburgischen Pflegegesellschaft.
In den eigenen vier Wänden alt werden, das wünschen sich fast 90 Prozent der Bevölkerung, wie eine repräsentative Bevölkerungsbefragung von Personen über 65 Jahren ergab. Mehr als jeder Zweite könnte sich alternativ eine Einrichtung für Betreutes Wohnen vorstellen. Nur für jeden Dritten ist dagegen das Wohnen bei Angehörigen oder ein Pflegeheim eine Option. Abgeschlagen mit nur rund fünf Prozent liegt die Pflege im Ausland. Dabei gibt es verschiedene Einflussfaktoren: Menschen mit höherer Bildung entscheiden sich eher für Betreutes Wohnen, männliche Senioren bevorzugen den Wohnort der Angehörigen, während heute noch jüngere Menschen sich später eher eine Auslandspflege vorstellen können.
Am wichtigsten an den Pflegepersonen ist den Befragten Empathie, Zuverlässigkeit und ein ordentliches Auftreten. Allerdings gibt es auch hier einige Besonderheiten: So wünschen sich Frauen im Pflegefall eher eine Pflegerin, Einwohner aus den neuen Bundesländern schätzen eine Pflegekraft mit dem gleichen kulturellen Hintergrund.
Befragt wurden auch Personen zwischen 45 und 64 Jahren zu den wesentlichen Aspekten von Dienstleistungen der ambulanten Pflegedienste. Dabei zeigte sich, dass die Qualität der Pflege für die Befragten das wichtigste Merkmal ist, während ein größeres Leistungsangebot (beispielsweise mehr Service und Flexibilität) von den Befragten nicht eindeutig bevorzugt wurden. Auch gibt es für zusätzliche Pflegestunden nur eine relativ geringe Zahlungsbereitschaft: im Durchschnitt liegt diese bei neun Euro pro zusätzlicher Pflegestunde und damit nur 16 Cent über dem aktuellen Mindestlohn. „Die Bevölkerungspräferenzen zu kennen ist wesentlich für künftige Reformen der Pflegeversicherung und führt letztendlich zu einer Verbesserung der Versorgung“, so Prof. Dr. Hans-Helmut König vom HCHE.
Mehr Lebensqualität in demenzgerechten Einrichtungen
Eine besondere Herausforderung stellt die zunehmende Anzahl von Menschen mit Demenz dar. „Durch die Pflegestärkungsgesetze und den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff profitieren Pflegebedürftige, insbesondere Menschen mit kognitiven Einschränkungen wie einer Demenz, von deutlichen Leistungsverbesserungen. Die Weichen für eine moderne und bedarfsorientierte Pflege sind gestellt“, so Hamburgs Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks. „In Hamburg steht für die Hilfe- und Pflegebedürftigen schon heute ein gut ausgebautes Angebot bereit. Analysen, wie auch die Befragung von Angehörigen, zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Diesen wollen wir fortsetzen und die Pflege älterer Menschen weiterentwickeln. Die Wahlfreiheit zwischen Pflegeheimen ist gut, wir brauchen aber auch mehr Alternativen zu Pflegeheimen. Jeder Pflegebedürftige in Hamburg soll die Möglichkeit haben, die für sich passende Form der Pflege in Anspruch nehmen zu können.“
HCHE-Forscher haben in diesem Zusammenhang die Lebensqualität von Demenzpatienten in Hamburger Pflegeheimen untersucht. Dabei wurden sowohl Angehörige als auch die Bezugspflegepersonen gebeten, die Lebensqualität der BewohnerInnen mit Demenz einzuschätzen. Es zeigt sich, dass die Selbständigkeit der Menschen mit Demenz einen wichtigen Effekt auf die Lebensqualität hat. Je selbständiger sie sind, desto höher ist die Lebensqualität. Dagegen führen herausfordernde Verhaltensweisen der BewohnerInnen, wie Ängste oder Depressionen, zu einer geringeren Lebensqualität. Pflegeeinrichtungen haben einen direkten Einfluss darauf, ob sich Menschen mit Demenz bei ihnen zu Hause fühlen: Dies zeigte sich bei den Einrichtungen, die sich sowohl räumlich als auch personell auf BewohnerInnen mit Demenz eingerichtet haben.
Neue Erkenntnisse liefert auch der Vergleich der Einschätzungen von Pflegenden und Angehörigen. Pflegepersonen schätzen die Lebensqualität ihrer BewohnerInnen mit Demenz in allen Dimensionen höher ein als die Angehörigen. Die befragten Pflegenden sind der Meinung, dass sich ihre BewohnerInnen mit Demenz im Großen und Ganzen im Pflegeheim zu Hause fühlen und wesentlich zufriedener sind als ihre Angehörigen dies empfinden. „Während die Bezugspflegepersonen die Lebensqualität eines Menschen mit Demenz vermutlich relativ zu anderen Demenzerkrankten betrachten, haben Angehörige eher die Person vor der Demenzerkrankung als Referenzpunkt. Wir denken, dass die Perspektive der Angehörigen als wichtige Ergänzung zu der der Pflegenden gesehen werden sollte“, so Prof. Dr. Vera Winter vom HCHE.
Jede dritte Bandscheiben-OP nicht leitlinienkonform (12.12.2016)
12. Dezember 2016
Jede dritte Bandscheiben-OP nicht leitlinienkonform
Männlich, mittlere Altersgruppe, im Beruf stehend – wer zu dieser Zielgruppe gehört, wird sich bei einem Bandscheibenvorfall eher einer Operation unterziehen als konservative Behandlungsmethoden auszuschöpfen. Und damit zugleich häufiger entgegen den Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurochirurgie handeln, wie eine Studie am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) ergab. Bei jedem dritten Bandscheiben-Patienten wird vorschnell operiert und dahinter stecken nicht immer nur finanzielle Erwägungen der Krankenhäuser. Viele Patienten fürchten, ohne Operation ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können.
Über die Erfahrungen der Patienten mit Bandscheiben-Operationen weiß man bislang in Deutschland nur wenig. Diese Lücke schließt die HCHE-Studie, die einen besonderen Fokus darauf legt, ob vor der Operation - sofern diese nicht durch einen Notfall begründet war - konservative Behandlungsmethoden ausgeschöpft wurden. Zu den konservativen Mitteln gehören etwa Krankengymnastik, Massagen und Schmerztherapie wie Injektionsbehandlungen, die über einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen erfolgen sollen. Frühere Studien zeigen, dass die konservative Behandlung mittelfristig vergleichbare Ergebnisse erzielt, jedoch weniger Kosten verursacht und keinerlei Operationsrisiken birgt. Insgesamt wurden mehr als 6.000 Versicherte der Barmer GEK befragt, die 2014 und 2015 an der Bandscheibe operiert wurden. Die Rücklaufquote betrug 47 Prozent.
Bei einem Drittel der Befragten wurden konservative Therapieverfahren nicht konsequent verfolgt oder trotz Ansprechens der Therapie operiert.
Auch wenn vielfach ohne akute Indikatoren operiert wurde, hielten die Patienten die Operation für den richtigen Weg. Insbesondere die Berufstätigen sorgten sich, ohne Operation ihren Beruf nicht mehr ausüben zu können. Außerdem waren sie der Überzeugung, dass ein Eingriff die bessere Möglichkeit sei, um die Schmerzen zu beheben. Zwar kommt es im Falle einer Bandscheiben-Operation oftmals zu einer Linderung der Beschwerden, doch immerhin zehn Prozent der Operierten leiden nachhaltig unter Komplikationen.
Diejenigen, die sich vor einem Eingriff eine Zweitmeinung eingeholt hatten, wurden häufiger konservativ therapiert. „Dies zeigt, wie wichtig es ist, entsprechende Beratungsangebote auszubauen“, erklärt HCHE-Forscher Prof. Dr. Mathias Kifmann und regt an, konservative Therapiemöglichkeiten insbesondere für Berufstätige besser verfügbar zu machen. In Anbetracht der oft zeitintensiven konservativen Therapien können auch spezialisierte Angebote für bestimmte Berufsgruppen von Nutzen sein. Nicht zuletzt sind auch die volkswirtschaftlichen Kosten interessant: Eine Bandscheiben-Operation kostet im Schnitt etwa 4.350 Euro. Überträgt man die Befunde, sind im Jahr 2014 durch womöglich vorschnelle Operationen Kosten im deutlich zweistelligen Millionenbereich entstanden.
Quelle:
Bäuml M, Kifmann M, Krämer J, Schreyögg J (2016). Bandscheibenoperationen – Patientenerfahrungen, Indikationsqualität und Notfallkodierung. In: Böcken J, Braun B, Meierjürgen R. Gesundheitsmonitor 2016. Bürgerorientierung im Gesundheitswesen. Kooperationsprojekt der Bertelsmann Stiftung und der BARMER GEK. Verlag Bertelsmann Stiftung: 187-195.
Hamburg Center for Health Economics (HCHE)
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Mehr als 60 Wissenschaftler/innen beschäftigen sich mit relevanten und politisch aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems. Der Fokus der Forschungsaktivitäten liegt dabei in den Bereichen Finanzierung des Gesundheitswesens, Gesundheitsökonomische Evaluation, Arzneimittelmärkte, Krankenhäuser und Ärzte sowie Bevölkerungsgesundheit.
Für Rückfragen:
Andrea Bükow
Tel.: 040 42838-9515
E-Mail: andrea.buekow@wiso.uni-hamburg.de
URL: www.hche.de
Europas größte Konferenz für Gesundheitsökonomie in Hamburg (13.07.2016)
13. Juli 2016
Europas größte Konferenz für Gesundheitsökonomie in Hamburg
Unter dem Slogan “Know the Ropes - Balancing Costs and Quality in Health Care” findet die größte europäische Konferenz für Gesundheitsökonomie erstmalig in Deutschland statt.
Das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) veranstaltet gemeinsam mit der European Health Economics Association (EuHEA) vom 13. bis 16. Juli die größte europäische Konferenz für Gesundheitsökonomie EuHEA Conference 2016 an der Universität Hamburg. Die seit 1996 im zweijährigen Turnus stattfindende europäische Konferenz kommt zum ersten Mal nach Deutschland. Bis zu 800 Wissenschaftler/innen aus aller Welt werden in Hamburg erwartet.
Das Thema der Konferenz “Know the ropes: Balancing Costs and Quality in Health Care” ist aktuellen gesundheitsökonomischen Herausforderungen gewidmet. Der Slogan mit dem nautischen Ausdruck „know the ropes“ – „wissen, wie es geht“ spiegelt den maritimen Charakter der Gastgeberstadt Hamburg wider.
Neben einer Vielzahl von fachwissenschaftlichen Vorträgen schlägt die Konferenz mit zwei praxisrelevanten Symposien die Brücke zwischen Wissenschaft und Praxis. In Kooperation mit KPMG diskutieren Forscher und Praktiker im Dialog die Frage „How Can Different Stakeholders in the Health Sector be Better Aligned?“. Das Symposium „Innovation in Provider Payment: Innovative Diabetes Reimbursement Systems in Europe“ in Zusammenarbeit mit der OECD und dem Bundesministerium für Gesundheit beleuchtet aktuelle Trends und Innovationen zur Verbesserung der Diabetesversorgung in Europa.
Plenarvorträge werden von den renommierten Gesundheitsökonomen Mark Sculpher von der University of York, Brigitte Dormont von der Universität Paris-Dauphine und Pedro Pita Barros von der Universidade Nova de Lisboa gehalten.
Die non-profit Konferenz wurde auch durch die großzügige Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Universität Hamburg, der Behörde für Wissenschaft und Forschung der Stadt Hamburg, dem Bundesministerium für Gesundheit, Signal Iduna, MSD, KPMG und der Techniker Krankenkasse ermöglicht.
Über das HCHE
Das Hamburg Center for Health Economics ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). 2010 gegründet, gehört das HCHE heute bereits zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Mehr als 60 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Ökonomie und Medizin arbeiten gemeinsam an Lösungen aktueller und künftiger Herausforderungen der Gesundheitsversorgung. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Für Rückfragen:
Hamburg Center for Health Economics, Universität Hamburg
Prof. Jonas Schreyögg, wissenschaftliche Leitung
E-Mail: jonas.schreyoegg@wiso.uni-hamburg.de
Elena Phillips, Geschäftsführerin
E-Mail: elena.phillips@wiso.uni-hamburg.de
Patienten: keine Angst vor effizienten Krankenhäusern (26.05.2016)
26. Mai 2016
Patienten: keine Angst vor effizienten Krankenhäusern
Patientenzufriedenheit und effizient arbeitende Fachabteilungen in Krankenhäusern schließen sich per se nicht aus. Das ist ein zentrales Ergebnis aktueller Forschung, die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) heute im Rahmen der Veranstaltung „Patientenzufriedenheit und Wirtschaftlichkeit: Widerspruch oder Wirklichkeit in deutschen Krankenhäusern?“ vorstellt. Dabei zeigt sich, dass dort, wo Patienten weder zufrieden noch unzufrieden sind, die Fachabteilungen durchschnittlich die niedrigste Effizienz aufweisen. Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE, empfiehlt Krankenhäusern verstärkt voneinander zu lernen: „Ein vermehrter Best-Practice-Austausch ermöglicht es, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung zu identifizieren.“
Die Erwartungen an die Krankenhausmanager sind hoch: einerseits müssen sie effizient arbeiten, andererseits wird eine hohe Qualität und Patientenzufriedenheit gefordert. In einer empirischen Studie in Kooperation mit der Weissen Liste e.V. zeigt sich, dass es hoch effiziente Fachabteilungen gibt, die gleichzeitig eine hohe Patientenzufriedenheit aufweisen. Das sind überwiegend Häuser, die sich in privater oder freigemeinnütziger Trägerschaft befinden und in der Regel auf ein enges Behandlungsspektrum spezialisiert sind. Darüber hinaus gibt es auch eine Reihe von Fachabteilungen, die zwar effizient sind, aber gleichzeitig eine niedrige Patientenzufriedenheit haben. Diese Krankenhäuser befinden sich tendenziell in öffentlicher Trägerschaft und zählen eher zu den großen Häusern. Fachabteilungen, die wenig effizient sind, können in der Regel nicht mit einer hohen Zufriedenheit punkten. „Überraschend war, dass Abteilungen mit nur geringer Effizienz nur eine mittlere Patientenzufriedenheit haben“, so Professor Schreyögg.
Wie können Krankenhäuser die Patientenzufriedenheit erhöhen? Welchen Einfluss haben Personalabteilungen auf die Patientenzufriedenheit? In einer weiteren empirischen Studie haben HCHE-Forscher erstmals untersucht, welchen Einfluss Personalmanagemententscheidungen auf die Patientenzufriedenheit haben.
Fachkräftemangel, steigende Abwanderungsraten bei Ärzten und eine hohe Fluktuation bei Pflegekräften hat in vielen Personalabteilungen in den letzten Jahren zur Einführung eines strategischen Personalmanagements geführt. Dieses, so zeigt die Studie, kann dazu beitragen Stellenbesetzungsprobleme sowohl bei Pflegekräften als auch bei Ärzten zu reduzieren. Die Verringerung von Stellenbesetzungsproblemen wirkte sich bei der Berufsgruppe der Ärzte direkt positiv auf die Patientenzufriedenheit aus. Dagegen ergaben sich keinerlei Effekte bei den Pflegekräften. „Dies kann daran liegen, dass Pflegekräfte nicht besetzte Stellen durch Mehrarbeit oder Unterstützung vom Funktionsdienst kompensieren, damit keine Qualitätsverschlechterung durch den Patienten wahrgenommen wird“, so Prof. Dr. Vera Winter vom HCHE. Zudem könnten Patienten eher schon auf Unterbesetzungen in der Pflege eingestellt sein und daher nicht mit geringerer Zufriedenheit reagieren, wenn sie diese tatsächlich vorfinden.
Der Einsatz von Zeitarbeitskräften als weitere Personalmanagementent-scheidung führt allerdings bei beiden Berufsgruppen zu einer geringeren Patientenzufriedenheit. Die Auswirkungen bei temporär angestellten Ärzten sind dabei noch größer. „Der größere Effekt lässt sich dadurch erklären, dass Ärzte insbesondere in der Interaktion mit Patienten eine Führungsaufgabe übernehmen und daher potentielle Koordinations- und Abstimmungsprobleme stärkere Auswirkungen haben. Andere Studien zeigten zudem, dass temporäre Arbeitskräfte tendenziell höhere Stress- und Unzufriedenheitslevel haben, welche sich negativ auf die Patientenzufriedenheit auswirken“, so Winter.
Die neuen Studien zu den Zusammenhängen von Patientenzufriedenheit einerseits und Effizienz beziehungsweise Personalmanagement andererseits zeigen, dass Krankenhäuser wirtschaftlich arbeiten und gleichzeitig eine hohe Patientenzufriedenheit erzielen können. Ein eindeutiger Trade-off zwischen Effizienz und Patientenzufriedenheit besteht nicht. Darüber hinaus lohnen sich Investitionen in ein strategisches Personalmanagement, dagegen sollte der Einsatz von Zeitarbeitskräften unter Patientenzufriedenheitsgesichtspunkten kritisch geprüft werden.
Bildmaterial zur Veranstaltung finden Sie hier.
Bundesforschungsministerium verlängert Förderung des Hamburg Center for Health Economics (25.05.2016)
25. Mai 2016
Bundesforschungsministerium verlängert Förderung des Hamburg Center for Health Economics
Das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) wird für weitere vier Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Für den Ausbau des Zentrums erhält das HCHE Forschungsgelder in Höhe von 2,1 Millionen Euro. Damit ist das HCHE eines von vier geförderten Zentren für Gesundheitsökonomie in Deutschland.
Mit den Forschungsmitteln wird das HCHE bis zum Jahr 2020 seine gesundheitsökonomische Forschung u. a. zu den Themen „Vergütungssystem der Krankenhäuser“ sowie „Versorgung von Demenzpatienten und psychisch kranker Menschen“ intensivieren. Zudem soll am HCHE untersucht werden, inwieweit mit Gesetzesänderungen (z. B. nächtliches Verkaufsverbot) ein exzessiver Alkoholkonsum – wie etwa das sogenannte „Komasaufen“ bei Jugendlichen – beeinflusst werden kann. Insgesamt werden sechs Projekte realisiert und zwei Nachwuchsforschungsgruppen eingerichtet.
Universitätspräsident Prof. Dr. Dieter Lenzen: „Ich gratuliere dem HCHE zu diesem Erfolg. Die interdisziplinäre Beschäftigung mit Fragen des Gesundheitssystems hat eine besondere gesellschaftliche Bedeutung. Die Verlängerung der Förderung durch das BMBF ist eine verdiente Anerkennung der bisherigen Arbeit des HCHE und zeigt, wie wichtig die gesundheitsökonomische Forschung an der Universität Hamburg ist.“
Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE: „Die Unterstützung durch das BMBF ermöglicht es uns, unsere Forschung in wichtigen gesundheitsökonomischen Feldern zu stärken sowie die nationale und internationale Sichtbarkeit des HCHE zu erhöhen.“
Das HCHE besteht seit 2012 und ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, der Fakultät für Betriebswirtschaft und der Medizinischen Fakultät der Universität Hamburg. Mehr als 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich mit aktuellen Themen des deutschen Gesundheitssystems wie „Finanzierung des Gesundheitswesens“, „Gesundheitsökonomische Evaluation“, „Arzneimittelmärkte“, „Krankenhäuser und Ärzte“ und „Bevölkerungsgesundheit“. Mit der BMBF-Förderung stärkt das HCHE sein Profil in drei der fünf Forschungsfelder. „Wir werden aktuelle gesundheitspolitische Themen untersuchen, deren Ergebnisse für Gesundheitspolitik und –praxis relevant sind“, so Schreyögg.
Im Forschungsfeld „Krankenhäuser und Ärzte“ werden Anreize im DRG-Vergütungssystem sowie solche, die Einfluss auf die Zusammenarbeit der verschiedenen Leistungserbringer haben, untersucht. So wird unter anderem erforscht, welchen Einfluss Preisveränderungen bei der DRG-Vergütung auf die Verhaltensreaktionen der Krankenhäuser haben. Ökonometrische Schätzungen dienen dazu, mögliche Fehlanreize zu identifizieren und Lösungen aufzuzeigen. Im Bereich „Gesundheitsökonomische Evaluation“ stehen die Produktivitätsverluste und –kosten im Mittelpunkt der Forschung, die durch eine geringere Erwerbstätigkeit der pflegenden Angehörigen bei Demenzpatienten entsteht. Zudem wird die Vergütung psychiatrischer Leistungen auf ihre Effizienz und Effektivität hin überprüft. Eine weitere Forschungsgruppe greift den patientenrelevanten Nutzen auf, um Empfehlungen für eine verzerrungsärmere Erhebung der gesundheitsbezogenen Lebensqualität abzuleiten. Im Forschungsfeld „Bevölkerungsgesundheit“ sollen ökonometrische Untersuchungen zeigen, inwieweit Gesetzesänderungen alkoholbedingte Krankenhauseinweisungen beeinflussen. Die Ergebnisse dienen insbesondere als Entscheidungsgrundlage für die Einführung nächtlicher Alkoholverkaufsverbote.
Krebspatienten: Ein internationales Forscherteam ermöglicht Einblicke in die Behandlung während der letzten Lebensmonate (20.01.2016)
20.01.2016
Krebspatienten: Ein internationales Forscherteam ermöglicht Einblicke in die Behandlung während der letzten Lebensmonate
Ob Krebspatienten im Krankenhaus oder zu Hause versterben, welche Behandlungen in den letzten Lebensmonaten durchgeführt und welche Kosten dadurch verursacht werden, hängt von strukturellen und kulturellen Besonderheiten in einem Land ab. Dies zeigt eine internationale Studie unter Beteiligung des Hamburg Center for Health Economics (HCHE), die die Inanspruchnahme und Kosten von Gesundheitsleistungen in den letzten Lebensmonaten in sieben Ländern untersucht hat. Obwohl die Hospitalisierungsrate zum Lebensende in Deutschland im internationalen Vergleich eher gering ist, verbringt immer noch ein großer Anteil der Patienten ihren letzten Lebenstag im Krankenhaus. Bezüglich Ressourceneinsatz und Kosten liegt Deutschland im Mittelfeld.
Deutschland zählt mit Belgien, England, Kanada und Norwegen zu den Ländern, in denen ein Großteil der Patienten im Krankenhaus verstirbt – im Gegensatz zu den Niederlanden und den USA. Die USA verzeichnet mit nur 22 Prozent die geringste Sterberate in Krankenhäusern. „Ein Grund dafür sind die Krankenhausvergütungssätze in Amerika, die wesentlich höher sind als in allen anderen Ländern“, so Prof. Dr. Rudolf Blankart, der sich gerade auf einem Forschungsaufenthalt in den USA befindet. „Der Kostendruck in den USA bedingte den erheblichen Ausbau von Pflegeeinrichtungen und Hospizen in den letzten Jahrzehnten und somit konnte die Sterberate in Krankenhäusern kontinuierlich gesenkt werden“. Diese Entwicklung ist aber durchaus im Sinne der Patienten: „Immer wieder konnte in Studien gezeigt werden, dass Patienten eher in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld und nicht im Krankenhaus versterben möchten“, so der HCHE-Forscher weiter.
Belgien, England, Kanada und Norwegen liegen an der Spitze der Krankenhauseinweisungen. In diesen Ländern wurden mehr als 80 Prozent der Krebspatienten in den letzten sechs Lebensmonaten ins Krankenhaus eingewiesen. In Belgien und Kanada verstirbt dort auch mehr als jeder zweite Krebspatient. In Deutschland werden nur rund 70 Prozent der Krebspatienten innerhalb der letzten sechs Monate im Krankenhaus aufgenommen, wobei nur circa 38 Prozent dort auch ihren letzten Lebenstag verbringen.
Obwohl in den USA die wenigsten Patienten im Krankenhaus versterben, der Anteil Krankenhauseinweisungen nur im Mittelfeld und die Aufenthaltsdauer bei rund der Hälfte im Vergleich zu den anderen Ländern liegt, gehören die USA mit Kanada und Norwegen zu den Ländern mit den höchsten Krankenhauskosten in den letzten sechs Lebensmonaten. Die hohen Krankenhauskosten der USA resultieren unter anderem aus der hohen Behandlungsintensität. Während in den USA über 40 Prozent der aufgenommenen Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, ist der Anteil in Deutschland mit rund acht Prozent bedeutend geringer. In den USA erfolgt die Behandlung in der Intensivstation aber nicht nur doppelt so häufig, sondern auch mit 3,6 Tagen mehr als doppelt so lang wie in allen anderen untersuchten Ländern.
Auch bezüglich des Einsatzes von Chemotherapie liegen die USA weit vorne. Während in den Niederlanden nur 18 Prozent eine Chemotherapie während der letzten 180 Tagen vor dem Tod erhalten, sind es in den USA fast 39 Prozent. Deutschland liegt mit 28 Prozent im internationalen Mittelfeld. „Der Einsatz einer Chemotherapie während der letzten Lebensmonate muss sorgsam abgewogen werden, da auch die neuen chemotherapeutischen Wirkstoffe oft mit erheblichen Nebenwirkungen einhergehen“, gibt Rudolf Blankart zu bedenken.
Insgesamt haben die beteiligten Forscher fast 400.000 Patienten in Amerika, Belgien, England, Kanada, den Niederlanden, Norwegen und Deutschland untersucht. „Eine Studie derartiger Größenordnung ist immer eine Herausforderung, da vergleichbare Daten in hoher Qualität in allen Ländern vorliegen müssen“, so Prof. Dr. Rudolf Blankart, der diese Arbeit im Rahmen des Harkness/B. Braun Stiftung Fellowship in Health Care Policy and Practice an der Brown University in den USA maßgeblich vorangetrieben hat.Für Deutschland wurden dabei anonymisierte Daten von der BARMER GEK ausgewertet.
Originalquelle: Bekelman JE, SD Halpern, CR Blankart, JP Bynum, J Cohen, R Fowler, S Kaasa, L Kwietniewski, HO Melberg, B Onwuteaka-Philipsen, M Oosterveld-Vlug, A Pring, J Schreyögg, CM Ulrich, J Verne, H Wunsch and EJ Emanuel: Comparison of Site of Death, Heath Care Utilization, and Hospital Expenditures for Patients Dying with Cancer in Seven Developed Countries. JAMA. 2016; 315(3):1-12
HCHE Research Results live: AMNOG - Erwartungen, Ergebnisse, Effekte (13.10.2015)
13. Oktober 2015
HCHE Research Results live: AMNOG - Erwartungen, Ergebnisse, Effekte
Neue Forschungsergebnisse rund um das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz (AMNOG) stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung HCHE Research Results live, die heute im Hamburg Center for Health Economics (HCHE) stattfindet. So gingen HCHE-Forscher unter anderem der Frage nach, ob ein vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) testierter Zusatznutzen die Marktdurchdringung, das heißt mehr Verordnungen durch Ärzte, beschleunigt. Zudem untersuchten sie, ob international einheitlich entschieden wird; also ein in Deutschland bestätigter Zusatznutzen auch in anderen Ländern festgestellt wurde. Unter welchen Bedingungen finden ferner patientenberichtete Endpunkte, insbesondere die Lebensqualität, Berücksichtigung im AMNOG-Verfahren? Diese Ergebnisse diskutieren die HCHE-Wissenschaftler mit Professor Josef Hecken, unparteiischer Vorsitzender des G-BA, und Dr. med. Martin Zentgraf,
Vorsitzender des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI). Moderiert wird die Veranstaltung, an der rund 100 Gäste teilnehmen, von Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
Seit Inkrafttreten von AMNOG 2011 werden alle neuen Medikamente auf ihren Zusatznutzen untersucht. Findet der G-BA diesen nicht, erfolgt starke Preisregulierung, beispielsweise die Eingruppierung in Festbetragsgruppen, im positiven Fall kommt es zu Preisverhandlungen zwischen dem GKV-Spitzenverband und dem Hersteller. Ein Forscherteam um Professor Dr. Tom Stargardt vom HCHE untersuchte, wie groß der Einfluss der G-BA-Entscheidung auf das Verordnungsverhalten der Ärzte ist. „Ärzte verschreiben eher ein neues Medikament mit Zusatznutzen“, weiß Tom Stargardt und errechnete, dass diese Arzneimittel in den ersten 20 Monaten nach Markteintritt von bis zu fünfmal so vielen Ärzten verschrieben werden wie Arzneimittel ohne Zusatznutzen. Damit wirkt der Begriff „Zusatznutzen“ wie eine erfolgreiche Marketingkampagne für den Hersteller.
Welchen Einfluss hat Lebensqualität auf die Entscheidung „Zusatznutzen“? HCHE-Wissenschaftler wollten wissen, ob Kriterien, wie „ein normales Alltagsleben führen“, „weniger Zeit für die tägliche Behandlung zu brauchen“ oder „weniger abhängig von Ärzten und Kliniken zu sein“, relevant sind und berücksichtigt werden? Professor Dr. Matthias Augustin vom HCHE fand mit seinem Team in einer qualitativen Studie heraus, dass diese zwar in den eingereichten Dossiers enthalten sind, aber nur selten zur Bewertung des Zusatznutzens herangezogen werden. Woran liegt das? „Obwohl die Lebensqualität in den gesetzlichen Vorgaben verankert ist, werden die eingebrachten Daten oft nicht akzeptiert“, so Matthias Augustin. Um statistisch signifikante und klinisch relevante Daten zu erhalten, müssen zahlreiche methodische Erfordernisse erfüllt sein. Pharmaunternehmen können aber durch geeignete Messinstrumente und Verfahren die Ausgangslage verbessern. „Entscheidend ist darüber hinaus die enge Zusammenarbeit zwischen Instrumententwicklern, Medizinern, den Kommissionen und der Industrie– unter Patientenbeteiligung“, so Augustin weiter.
„Ein frühzeitiger Konsens über die sachgerechte Methodenwahl erspart Konflikte bei der Nutzenbewertung und erhöht die Chance für den Patienten auf schnellen Zugang zu innovativen Medikamenten“. Kommen Institutionen in anderen Ländern zu denselben Entscheidungen wie der G-BA? „Nein“, bestätigt Tom Stargardt, der die G-BA-Entscheidungen mit denen vergleichbarer Institutionen in England, Schottland und Australien untersuchte. Es gibt in der Regel nur wenige Übereinstimmungen zwischen den Ländern. So zeigte sich zum Beispiel, dass der G-BA von den 39 Patientengruppen, bei denen das englische NICE einen Zusatznutzen fand, nur 19-mal auf Zusatznutzen entschied. Ähnlich ist das Verhältnis im Vergleich zu den anderen Ländern. „Wir gehen davon aus, dass die Unterschiede durch den unterschiedlichen Prozess, die sich unterscheidenden Bewertungskriterien und den unterschiedlichen Umgang mit Evidenz zustande kommen“, so Tom Stargardt.
HCHE-Forscherin erhält Ludwig-Erhard-Preis 2015 (06.07.2015)
6. Juli 2015
HCHE-Forscherin erhält Ludwig-Erhard-Preis 2015
Dr. Vera Antonia Büchner, 31, wurde jetzt vom Ludwig-Erhard-Initiativkreis Fürth für ihre Forschung am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) ausgezeichnet. In ihrer Dissertation „Strategic Changes and Hospital Performance“ untersucht sie, wie Kliniken effizienter und profitabler betrieben werden können und leitet daraus wirtschaftliche Handlungsempfehlungen für Krankenhäuser ab. "Mit ihrer Arbeit beschreitet Frau Dr. Büchner innovative Wege, indem sie neue Forschungsansätze verfolgt und neue Methoden nutzt - und so den wissenschaftlichen Diskurs in ihrem Fachgebiet vorantreibt", so die Jury-Begründung. Der Ludwig-Ehrhard-Preis ist mit 4.000 € dotiert. Die Dissertation ist Teil eines Forschungsprojektes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF).
Kooperationen, Verbundeffekte und die Beziehung zwischen Aufsichtsgremium und Geschäftsleitung
Antonia Büchner forschte während ihrer Zeit am HCHE über Krankenhauskooperationen, Verbundeffekte und den Einfluss von Aufsichtsgremium auf die strategische Zielplanung. Es zeigte sich, dass Kooperationen positive Effekte auf die Produktivität erzielen, wenn diese unter Gleichgesinnten (Kooperationen zwischen Krankenhäusern auf administrativer Ebene) geschlossen werden. Allerdings: Wer sowohl rein administrative Partnerschaften mit anderen Krankenhäusern als auch mit Ärzten oder Reha-Einrichtungen eingeht, muss mit spürbar negativen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis rechnen. In einer weiteren Studie, die Daten von über 800 Krankenhäusern über einen Zeitraum von bis zu elf Jahren umfasste, untersuchte Antonia Büchner, ob Krankenhausverbünde dauerhaft effizienter und profitabler arbeiten. Und stellte fest, dass die Effizienz auch nach Jahren noch positiv ist, die Profitabilität jedoch nur im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss steigt. Was können – unabhängig von Verbünden – Aufsichtsgremien tun, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern? „Sich aktiv in die strategische Zielplanung einbringen“, so Antonia Büchner, „und dabei die richtige Balance zwischen positiver Einflussnahme und negativer Einmischung finden.“ Auch die Besetzung des Aufsichtsgremiums spielt eine Rolle: Diversität verbessert oft die Beziehung zwischen Aufsichtsgremium und Geschäftsführung, allerdings kann dies auch negativ wirken, wenn die Heterogenität zu groß wird.
Über den Ludwig-Ehrhard-Preis:
Der Ludwig-Erhard-Initiativkreis Fürth lobt jährlich den „Fürther Ludwig-Ehrhard-Preis“ aus, um Forschungstätigkeiten zu fördern, in denen verstärkt die Faktoren Innovation, Praxisnähe, Realisierbarkeit, wirtschaftlicher Nutzen und die Auswirkungen auf die Menschen berücksichtigt sind. Der Auszeichnung liegt der Gedanke zugrunde, praxisrelevante Arbeiten auszuzeichnen, die einen gesamtwirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Bezug erkennen lassen.
HCHE-Forscher mit Harkness Fellowship und Fulbright Stipendium ausgezeichnet (20.05.2015)
20. Mai 2015
HCHE-Forscher mit Harkness Fellowship und Fulbright Stipendium ausgezeichnet
Mit Prof. Dr. Rudolf Blankart und Eva Oppel haben gleich zwei HCHE-Forscher begehrte und hoch dotierte Auszeichnungen erhalten: Rudolf Blankart erhält das Harkness/B. Braun Stiftung Fellowship in Health Care Policy and Practice, eine der prestigeträchtigsten Programme im Gesundheitswesen. Eva-Maria Oppel wurde mit einem Fulbright Doktorandenstipendium ausgezeichnet. Das Fulbright Stipendium gilt als eines der angesehensten Stipendien weltweit.
Prof. Dr. Rudolf Blankart, 35 Jahre, ist Juniorprofessor für Technologie- und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen. Er arbeitet seit 2010 am HCHE und hat seitdem vor allem im Bereich Versorgungsmanagement geforscht. Das Harkness Fellowship ermöglicht es ihm, seine Forschungstätigkeit ein Jahr an der Brown University in Providence (Rhode Island), USA, fortzusetzen. In Zusammenarbeit mit Professor Vince Mor wird er das strategische Verhalten von Pflegeheimen auf Vergütungsänderungen analysieren. Es soll insbesondere die Frage beantwortet werden, ob Pflegeheime unterschiedlich auf die Anreize reagieren und wenn ja, warum. So ist es vorstellbar, dass zusätzliche Mittel in Qualitätsverbesserungen investiert werden oder aber auch einen ineffizienten Status Quo zementieren. In einem weiteren Projekt wird Rudolf Blankart als Teil eines internationalen Forscherteams unter Führung von Professor Ezekiel Emanuel von der University of Pennsylvania die regionale Variation in der palliativmedizinischen Versorgung von Krebspatienten untersuchen.
Eva-Maria Oppel, 27 Jahre, absolviert seit 2013 ihr Promotionsstudium am HCHE. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt dabei auf Personalmanagement und -entwicklung in Krankenhäusern. Mit dem Fulbright Stipendium wird sie an der Northeastern University in Zusammenarbeit mit dem Veterans Health Administration (VA) Center, beides Boston, forschen. Ihre aktuelle Forschung beschäftigt sich mit dem Kooperationsverhalten zwischen Ärzten und Pflegekräften. Insbesondere wird untersucht, wie und wodurch Kooperationen zwischen den Berufsgruppen verbessert werden können und welche Auswirkungen das Kooperationsverhalten auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit hat. Hierzu werden empirische Analysen anhand von Fragebogen- und Strukturdaten aus amerikanischen Krankenhäusern durchgeführt. Aufbauend auf den Ergebnissen sollen Handlungsempfehlungen für den deutschen Krankenhausmarkt gewonnen werden.
Das vom Commonwealth Fund initiierte Harkness Fellowship Programm richtet sich an mid-career Forscher und Praktiker, die sich mit gesundheitspolitischen Fragestellungen auseinandersetzen. Der Commonwealth Fund ist eine philanthropische private Stiftung mit dem Sitz in New York, die sich zum Ziel gesetzt hat ein leistungsfähiges Gesundheitssystem mit einem Fokus auf Zugang, besserer Qualität und höherer Effizienz zu fördern. Seit 2008 finanziert zusätzlich die B. Braun Stiftung als deutscher Partner des Commonwealth Funds ein zweites Harkness Fellowship mit einem speziellen Fokus auf Forschung im Pflegebereich. Das Stipendium ermöglicht nicht nur das Vorantreiben der eigenen Forschungstätigkeit, sondern erlaubt es den Stipendiaten auch einen tiefen Einblick in das amerikanische Gesundheitssystem zu erhalten, ihre Forschungsfähigkeiten auszubauen und internationale Kontakte zu knüpfen.
Das Fulbright Stipendium ermöglicht den Austausch zwischen den Vereinigten Staaten und mehr als 180 Ländern weltweit. 53 Fulbright Alumni erhielten Nobelpreise, 82 Alumni Pulitzer Preise. Unter den deutschen Fulbright Alumni sind unter anderem Ulrich Wickert und Doris Dörrie. Ziel des Programms ist es, durch die Zusammenarbeit der verschiedenen Nationalitäten und dem Austausch von Wissen und Fähigkeiten ein besseres gegenseitiges Verständnis zu erzielen.
Knochenbrüche durch Osteoporose verursachen hohe Kosten (13.04.2015)
13. April 2015
Knochenbrüche durch Osteoporose verursachen hohe Kosten
Für Frauen ab 50 Jahre gehören osteoporotische Knochenbrüche zu den häufigsten Leiden, noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Brustkrebs. Diese verursachen nicht nur erhebliche Einbußen in der Lebensqualität, sondern auch enorme Kosten. Forscher am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) haben jetzt erstmals die zu erwartenden Frakturzahlen und Lebenszeitkosten für Knochenbrüche bei Frauen mit und ohne Osteoporose errechnet. Das Ergebnis: Knochenbrüche verursachen bei 50-jährigen Frauen mit Osteoporose mehr als dreimal so hohe Lebenszeitkosten für Behandlung und Pflege als bei Frauen, die niemals an Osteoporose erkranken. Die größten Kostentreiber sind dabei Klinikaufenthalte und frakturbedingte Langzeitpflege: auf diese beiden entfallen nahezu 70 Prozent der Gesamtkosten.
Untersucht wurden sechs häufig auftretende Frakturtypen an Hüfte und sonstigem Oberschenkel, Handgelenk, Wirbelkörper, Oberarm und Becken. Insgesamt wurden die Zahl der Knochenbrüche und die damit verbunden Kosten in zwei Risikogruppen (mit und ohne Osteoporose) mit je 200.000 hypothetischen Frauen über die gesamte erwartete Lebenszeit simuliert. Berücksichtigt wurden sowohl die stationären und ambulanten Behandlungs- und Pflegekosten als auch die Kosten einer Pflege durch Familienangehörige.
Mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 40 und 50 Prozent muss eine 50-jährige Frau damit rechnen, im Laufe ihres weiteren Lebens eine oder mehrere osteoporotische Frakturen zu erleiden. Wer mit 50 Jahren bereits Osteoporose hat, bei dem liegen die zu erwarteten Lebenszeitkosten für Knochenbrüche um das 3,3-fache höher als bei Frauen, die niemals an Osteoporose erkranken werden. Letztere verursachen für die Behandlung von Knochenbrüchen und anschließende Pflege durchschnittlich rund 5.400 € an Lebenszeitkosten, bei Osteoporose-Patientinnen im Alter von 50 Jahren sind dies rund 18.600 €. Für Frauen mit einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit für Osteoporose liegt dieser Wert bei rund 11.000 €. Auffallend ist zudem, dass die Kosten merklich steigen, wenn bereits frühere Frakturen vorliegen. Insgesamt fallen 70 Prozent der Kosten für die stationäre Behandlung und Langzeitpflege an, knapp 20 Prozent sind ambulante Aufwendungen und 10 Prozent entfallen auf die familiäre Pflege. „Mit der zu erwartenden demografischen Entwicklung werden die Gesamtkosten für osteoporotische Frakturen weiter stark steigen“, so Prof. Dr. Hans-Helmut König, Forscher am HCHE. „Dies wird sich insbesondere auf die Kosten von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen auswirken und damit sowohl die Sozialversicherung als auch die Patientinnen und deren Angehörige finanziell belasten.“
Zu den häufigsten Brüchen gehören Hüftfrakturen: So bekommt durchschnittlich jede fünfte Frau eine Hüftfraktur im Laufe ihres Lebens, wobei circa 58 Prozent aller Hüftfrakturen direkt auf Osteoporose zurückzuführen sind. Der zweithäufigste Frakturtyp ist das Handgelenk, allerdings sind hier die Unterschiede zwischen Frauen mit und ohne Osteoporose vergleichsweise gering. Vergleichsweise selten treten Frakturen am Becken, am Oberarm und am sonstigen Oberschenkel auf. Sie kommen jedoch wesentlich häufiger bei Osteoporose beziehungsweise in der Gruppe mit einer durchschnittlichen Wahrscheinlichkeit dafür vor.
Gleichzeitig führen Hüftfrakturen auch zu den größten Kosten von den sechs untersuchten Frakturtypen. Sie alleine verursachen bereits etwa 43 Prozent aller Behandlungskosten, gefolgt von Wirbelfrakturen mit 18 Prozent und Oberarmbrüchen mit 15 Prozent.
Die Forscher fanden weiter heraus, dass im Alter zwischen 50 und 70 Jahren nur ein relativ geringes Risiko für Knochenbrüche besteht und demzufolge nur wenig Kosten anfallen. Einen sprunghaften Anstieg gibt es ab 75 Jahre. Bis zu einem Alter von 95 Jahren steigen die jährlichen Kosten für Behandlung und Pflege von Knochenbrüchen um 600 Prozent.
Osteoporotische Frakturen bedeuten eingeschränkte Mobilität, weniger Lebensqualität und eine höhere Sterbewahrscheinlichkeit. Insbesondere ältere Patientinnen sind oft auf externe Hilfe angewiesen. „Wer Osteoporose bereits hat oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür besitzt, kann durch verschiedene Maßnahmen wie Sturzpräventionsprogramme, Balance-Training, körperliche Aktivität oder Medikamente das Risiko für eine Fraktur verringern“, so der HCHE-Forscher Florian Bleibler und rät zugleich, die vorhandenen Präventionsprogramme weiter auszubauen.
Originalbeitrag
Florian Bleibler et al: Expected lifetime numbers and costs of fractures in postmenopausal women with and without osteoporosis in Germany: a discrete event simulation model; BMC Health Services Research 2014, 14:284
Nächtliches Alkoholverkaufsverbot verringert Zahl der Krankenhausaufenthalte (10.02.2015)
10. Februar 2015
Nächtliches Alkoholverkaufsverbot verringert Zahl der Krankenhausaufenthalte
Gemeinsame Pressemitteilung des DIW Berlin und des Hamburg Center for Health Economics (HCHE)
Infolge des nächtlichen Alkoholverkaufsverbots in Baden-Württemberg ist die Zahl der alkoholbedingten Krankenhausaufenthalte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen um sieben Prozent gesunken. Bei älteren Erwachsenen hat die im Jahr 2010 in Kraft getretene Regelung hingegen keine Auswirkungen. Das haben Forscher des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) erstmals herausgefunden. „Das sogenannte Komasaufen unter Jugendlichen ist für die Betroffenen mit hohen Gesundheitsrisiken verbunden und gesellschaftlich ein Problem. Wenn dies durch den erschwerten Zugang zu Alkohol reduziert werden kann, ist ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot auch für andere Bundesländer ein interessanter politischer Ansatz“, sagen die beiden Studienautoren Thomas Siedler vom HCHE und Jan Marcus vom DIW Berlin.
Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes haben sich die alkoholbeding-ten Krankenhausaufenthalte von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland innerhalb von nicht einmal zehn Jahren (2002 bis 2010) mehr als verdoppelt. Im März 2010 reagierte Baden-Württemberg mit einem Alkohol-verkaufsverbot: Zwischen 22 und 5 Uhr gehen dort seitdem an Tankstellen, Supermärkten und Kiosken keinerlei alkoholische Getränke mehr über die Ladentheke. Lediglich in Restaurants und Bars ist der Ausschank von Alkohol weiter erlaubt.
Die Forscher aus Berlin und Hamburg konnten nun erstmals zeigen, dass dieses nächtliche Alkoholverkaufsverbot wirkt – wenn auch nicht übermäßig stark: Bei den 15- bis 19-Jährigen und bei den 20- bis 24-Jährigen sind die alkoholbedingen Krankenhauseinlieferungen seit Beginn des Verkaufsverbots jeweils um etwa sieben Prozent gesunken – am stärksten bei jüngeren Männern. Zudem wurden infolge des Verkaufsverbots weniger Personen aufgrund von Körperverletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. „Baden-Württemberg konnte sich damit dem allgemeinen Trend widersetzen“, so Jan Marcus vom DIW Berlin. „Während die alkoholbedingten Krankenhauseinlieferungen in den anderen Bundesländern anstiegen, erzielte Baden-Württemberg durch das nächtliche Alkoholverkaufsverbot bereits kurzfristig eine Stagnation.“ Allein in den ersten 22 Monaten nach Inkrafttreten konnten über 700 alkoholbedingte Krankenhauseinlieferungen in Baden-Württemberg vermieden werden.
„Jugendliche kaufen seltener Alkohol auf Vorrat und haben in der Regel weniger Geld zur Verfügung, so dass sie Alkohol öfter in Supermärkten und Tankstellen kaufen als Erwachsene, die einfacher auf Kneipen und Restaurants ausweichen können“, erklärt Siedler. Daher entfalte das nächtliche Alkoholverkaufsverbot seine Wirkung nur bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Bei den älteren Erwachsenen ab 25 Jahren stellen die Forscher dagegen keine signifikante Reaktion fest. Marcus: „Hier spielen auch ein höheres Einkommen und eine eigene Wohnung eine Rolle. Der Alkoholkonsum findet geplanter und weniger in der Öffentlichkeit statt.“
Die groß angelegte Studie von HCHE und DIW Berlin hat erstmals die kurz-fristigen gesundheitlichen Effekte des Alkoholverkaufsverbots in Baden-Württemberg untersucht. Die Forscher werteten dafür eine 70-Prozent-Stichprobe aller Krankenhauseinlieferungen in Deutschland für die Jahre 2007 bis 2011 aus (Krankenhausdiagnosestatistik). Alleine für das Jahr 2011 analy-sierten die Forscher Daten von 13 Millionen Krankenhausaufenthalten. Durch den Vergleich mit anderen Bundesländern konnten sie generelle Veränderun-gen im Alkoholkonsum herausrechnen und auch wirtschaftliche und demografische Veränderungen in den einzelnen Bundesländern berücksichtigen.
Originalbeitrag
Jan Marcus und Thomas Siedler: Reducing binge drinking? The effect of a ban on late-night off-premise alcohol sales on alcohol-related hospital stays in Germany; Journal of Public Economics, 2015.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0047272714002564
Gesundheitsminister Hermann Gröhe beruft Wissenschaftler der Universität Hamburg in den Sachverständigenrat (26.01.2015)
26. Januar 2015
Prof. Dr. Jonas Schreyögg, Direktor des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) der Universität Hamburg, ist von Gesundheitsminister Hermann Gröhe in den Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen berufen worden. Prof. Schreyögg erhält heute, am 26.1.14, im Rahmen der konstituierenden Sitzung des Rates die offizielle Berufungsurkunde.
Dem Sachverständigenrat gehören insgesamt sieben Mitglieder aus den Fachgebieten Medizin, Ökonomie, Sozialwissenschaften und Rechtswissenschaften an. Der Rat beurteilt alle zwei Jahre die Entwicklung der gesundheitlichen Versorgung – sowohl medizinisch als auch wirtschaftlich. Zudem erarbeitet er Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens.
Das HCHE ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf. Unter der Leitung von Professor Schreyögg, 38, arbeiten mehr als 50 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an aktuellen und künftigen Fragestellungen der Gesundheitsversorgung. Prof. Schreyögg hält zudem die Professur für Management im Gesundheitswesen an der Fakultät für Betriebswirtschaft der Universität Hamburg.
HCHE Research Results live: Reformvorschlag für eine Neuordnung des Krankenversicherungssystems (17.11.2014)
17. November 2014
Wie sieht ein sozial ausgewogenes Krankenversicherungssystem aus? Diese Frage steht im Mittelpunkt der Veranstaltung HCHE Research Results live, die heute im Hamburg Center for Health Economics stattfindet. Mit dem Titel „Fairer Systemwettbewerb zwischen Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung“ stellen Professor Dr. Mathias Kifmann und Professor Dr. Martin Nell ihren Reformvorschlag zur Neuordnung von GKV und PKV vor. Anschließend diskutieren sie ihren Vorschlag mit Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der Techniker Krankenkasse, und Dr. Clemens Muth, Vorstandsvorsitzender der DKV AG. Moderiert wird die Veranstaltung, an der rund 100 Gäste teilnehmen, von Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
Zahlreiche Reformbemühungen prägen die Diskussion um das deutsche Krankenversicherungssystem. Allen gemeinsam ist, dass sie die Abschaffung eines Systems und damit die Schaffung eines einheitlichen Krankenversicherungsmarktes zum Ziel haben. Der neue Reformvorschlag ermöglicht es, dass GKV und PKV nebeneinander bestehen bleiben und zugleich ein fairer Wettbewerb zwischen beiden Systemen entsteht. „Die Versicherten erhalten zudem umfassende Wahlfreiheit und anstelle des heutigen Selektionswettbewerbs tritt ein Leistungswettbewerb“, so Prof. Kifmann, HCHE-Forscher.
Der Reformvorschlag hat fünf zentrale Punkte:
- Jeder Bürger zahlt immer den Beitrag zum Gesundheitsfonds.
- Bei einem Wechsel in die PKV erhält der private Krankenversicherer den Beitrag, den auch ein gesetzlicher Krankenversicherer aus dem Gesundheitsfonds erhalten würde.
- Zur Sicherung der Nachhaltigkeit wird ein Teil der Einnahmen des Gesundheitsfonds für den Aufbau eines Kapitalstocks verwendet.
- PKV-Verträge werden wie bisher auch als langfristige Verträge ohne ordentliches Kündigungsrecht des Versicherers geschlossen. Der Unterschied zum Status quo besteht lediglich darin, dass die erwarteten Leistungen aus dem Gesundheitsfonds in die Kalkulation eingehen.
- Jeder Bürger hat die Wahl zwischen GKV und PKV – unabhängig vom Einkommen.
Kern des Reformvorschlags ist es, dass alle einkommensabhängig in den Gesundheitsfonds einzahlen – unabhängig davon, ob sie privat oder gesetzlich versichert sind. Dadurch wird erreicht, dass der Solidarbeitrag eines Versicherten nicht mehr von der Wahl des Krankenversicherungssystems abhängt. Dieser Solidarbeitrag entspricht der Differenz zwischen dem Beitrag, den ein Versicherter für den Gesundheitsfonds zu entrichten hat, und dem Beitrag, der aus dem Gesundheitsfonds an den Krankenversicherer gezahlt wird. Ist die Differenz positiv, was bei Versicherten mit einem hohen Einkommen und einem geringen Krankheitsrisiko der Fall ist, zahlen diese die Differenz als Solidarbeitrag. Personen mit geringem Einkommen und hohem Krankheitsrisiko erhalten dagegen einen Sozialbeitrag in Höhe der Differenz.
Somit käme dem bestehenden Gesundheitsfonds eine noch zentralere Rolle zu, da auch die PKV-Versicherten darin einzahlen. Die Höhe der Zahlungen an die Kassen bemisst sich derzeit am morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich (Morbi-RSA), der gesetzlich auf 80 berücksichtigte Vorerkrankungen beschränkt ist. Hier sehen die Forscher weiteren Verbesserungsbedarf. „Ein leistungsfähiger Morbi-RSA ist sowohl für einen fairen Wettbewerb als auch für die Berechnung korrekter Solidarbeiträge unverzichtbar. Daher ist die Erweiterung des Morbi-RSA essentiell“, fordert Prof. Nell, Direktor des Instituts für Versicherungsbetriebslehre an der Universität Hamburg.
Für GKV und PKV bedeutet der Reformvorschlag, dass die jeweiligen Geschäftsmodelle grundsätzlich beibehalten werden. Die einzige Änderung für die PKV besteht darin, dass sie für einen Versicherten eine risikogerechte Zahlung aus dem Gesundheitsfonds erhält, die in ihre Prämienkalkulation eingeht, so dass die Versicherungsprämie und die Höhe der Alterungsrückstellungen niedriger ausfallen werden. Gleichzeitig erhalten sie jedoch Zugang zu einem riesigen Markt – dem der GKV-Versicherten.
Denn derzeit sind rund 90 Prozent der Bevölkerung GKV-versichert. Für diese würde sich ein Wechsel in die PKV nur noch dann lohnen, wenn sie für eine umfassendere Versorgung mehr zu zahlen bereit sind beziehungsweise wenn Prämiensenkungen durch Selbstbehalte oder Beitragsrückerstattungen bevorzugt werden. Für gut verdienende GKV-Versicherte ist ein Wechsel rein aus der Überlegung heraus, Solidarbeiträge zu sparen, nicht mehr lukrativ. „Private Versicherungen müssen mit einem attraktiveren Angebot, zum Beispiel bei Leistungen oder der Gestaltung von Selbstbeteiligungstarifen, überzeugen - zum Wohle aller Versicherten“, erklärt Prof. Kifmann.
Über das HCHE
Das Hamburg Center for Health Economics ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). 2010 gegründet, gehört das HCHE heute bereits zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Mehr als 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Ökonomie und Medizin arbeiten gemeinsam an Lösungen aktueller und künftiger Fragestellungen der Gesundheitsversorgung. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Für Rückfragen:
Hamburg Center for Health Economics, Universität Hamburg
Andrea Bükow, Tel.: 040 42838-9515,
E-Mail: andrea.buekow"AT"wiso.uni-hamburg.de
Elena Granina, Tel.: 040 42838-9516,
E-Mail: elena.granina"AT"wiso.uni-hamburg.de
URL: http://www.hche.de
Krankenhausverbünde nachhaltig effizienter (10.11.2014)
10. November 2014
Bringen Krankenhausverbünde nur einen kurzfristigen Einsparungseffekt oder sind diese auch langfristig erfolgreicher als Einzelkrankenhäuser? In einer jetzt veröffentlichten Studie fanden Forscher des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) heraus, das Krankenhausverbünde dauerhaft wirtschaftlicher arbeiten. Allerdings: Die Profitabilität steigt nur im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass der Zusammenschluss von Krankenhäusern sich positiv auf die Leistungsfähigkeit auswirkt. Untersucht wurden über 800 Krankenhäuser über einen Zeitraum von bis zu elf Jahren. Dies ist die erste Studie, die sowohl die Änderungen in der Effizienz als auch hinsichtlich der Profitabilität nach Eintritt in einen Krankenhausverbund umfassend und auf Basis eines großen Datenbestands analysiert.
Aufgrund der veränderten Marktbedingungen ist es für Einzelhäuser immer schwerer ohne Kooperationen wettbewerbsfähig zu bleiben. Verbundeintritte liegen daher nach wie vor im Trend, sind aber nur eine Möglichkeit sich kooperativ zu binden. Im Mittelpunkt dieser Forschung stehen neue Verbünde mit einem zentralen Eigentümer, keine Netzwerke oder strategischen Allianzen. „Dass Krankenhäuser nach einem Zusammenschluss sowohl im administrativen Bereich als auch durch gemeinsame Support-Abteilungen (Apotheken et cetera) Kosten einsparen können, ist nicht überraschend und konnten wir bereits in einer früheren Studie nachweisen”, so Dr. Vera Antonia Büchner, Wissenschaftlerin am HCHE. „Wir wollten jedoch herausfinden, ob derartige Einsparungen nur eine Übergangserscheinung sind oder ein Verbundeintritt auch langfristig positive Auswirkungen auf Effizienz und Profitabilität hat.“
Transaktionsphasen führen zunächst einmal zu Effizienzeinbußen, zum Beispiel durch die gestiegene Komplexität, durch Umstrukturierungen und Investitionen in neue Infrastruktur. Zudem bedeutet der Verbundeintritt auch den Verlust von Autonomie und Kontrolle. Gestiegene Kommunikationskosten und längere Entscheidungswege führen ebenfalls zu kurzfristigen Effizienzdefiziten. „Insgesamt betrachtet sind dadurch zunächst die Effizienzzuwächse kleiner, sie sind aber immer positiv. Wirkliche Verluste werden nicht erzielt“, erklärt Dr. Büchner. Gleichzeitig können Verbünde bessere Einkaufspreise beziehungsweise Mengenrabatte erzielen und so ihre Kosten weiter reduzieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Krankenhäuser nach einem Verbundeintritt bis zu 3,4 Prozent effizienter arbeiten als Krankenhäuser, die zu keinem Verbund gehören. Und dies über Jahre hinweg. „Somit ist nicht von einem vorübergehenden Effekt, sondern von einem permanenten Einfluss auf die Effizienz auszugehen“, erklärt Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. Eine weitere Erkenntnis der Forschungsarbeit: Je mehr Erfahrung Krankenhäuser mit einer Verbundorganisation haben, desto mehr Vertrauen haben sie in die langfristigen Erfolge und desto größer sind die Effizienzgewinne - sowohl bezogen auf die Kosten als auch auf den technischen Einsatz.
Der Verbundeintritt ist für Krankenhäuser auf jeden Fall eine geeignete Maßnahme, um die Effizienz zu steigern. Allein aus finanziellen Überlegungen heraus sollte ein Verbundeintritt nicht erfolgen, wie die Ergebnisse zur Profitabilität zeigen. Zur Messung wurden hier verschiedene Finanzkennzahlen ausgewertet: So stieg die Umsatzrentabilität um 2,6 Prozent und der Return-on-Investment (ROI) um 3,5 Prozent ausschließlich innerhalb eines Jahres nach dem Eintritt im Vergleich zu der Gruppe der Einzelkrankenhäuser. Zudem wurden das Betriebsergebnis und der Gewinn nach Steuern analysiert, ebenfalls mit Zuwächsen im ersten Jahr nach Verbundeintritt. Bei allen Finanzkennzahlen zeigten sich jedoch keine Signifikanzen mehr im Folgejahr. „Daher müssen wir derzeit davon ausgehen, dass der finanzielle Effekt eher vorübergehend ist“, so Professor Schreyögg.
Aufbauend auf dieser Forschungsarbeit werden HCHE Wissenschaftler mögliche Unterschiede zwischen Verbund- und Einzelhäusern - insbesondere bezogen auf die Gewinneffizienz - in zukünftigen Studien genauer untersuchen.
Originalbeitrag
Büchner V A, Hinz V, Schreyögg J (2014) Health Systems: Changes in Hospital Efficiency and Profitability, Health Care Management Science (online first, doi: 10.1007/s10729-014-9303-1)
Über das HCHE
Das Hamburg Center for Health Economics ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). 2010 gegründet, gehört das HCHE heute bereits zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Mehr als 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Ökonomie und Medizin arbeiten gemeinsam an Lösungen aktueller und künftiger Fragestellungen der Gesundheitsversorgung. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Über Produktivität²
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts „Produktivität²: Produktive Innovationsprozesse zur Erhöhung der Produktivität von Gesundheitsdienstleistern“ erforscht die Universität Hamburg gemeinsam mit mehreren Partnern verschiedene Fragestellungen im Bereich der Krankenhausproduktivität.
Krankenhaus-Kooperationen: Am erfolgreichsten unter Gleichgesinnten (21.05.2014)
21. Mai 2014
Krankenhaus-Kooperationen: Am erfolgreichsten unter Gleichgesinnten
Kooperationsvereinbarungen stehen in den Vorstandsetagen der Krankenhäuser regelmäßig auf der Tagesordnung. Doch nicht jede Partnerschaft bringt auch die erhofften positiven Effekte. Am produktivsten sind diejenigen unter Gleichgesinnten – also mit anderen Krankenhäusern, wie jetzt Forscher am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) herausgefunden haben. Sie untersuchten dabei sowohl administrative als auch medizinische Kooperationen im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit. Neben der Intensität wurde auch die Breite der Partnerschaften analysiert. Dies ist die erste Studie, die das Kooperationsverhalten deutscher Krankenhäuser basierend auf einer umfassenden Datenerhebung analysiert. Die Ergebnisse werden jetzt in der Fachzeitschrift Health Care Management Review veröffentlicht.
Insbesondere die Kooperationen auf administrativer Ebene ergaben messbare Auswirkungen auf die Produktivität der Krankenhäuser. So wirkte es sich besonders positiv aus, wenn Krankenhäuser beispielsweise beim Einkauf und Controlling zusammenarbeiten, eine Apotheke oder Serviceeinrichtungen wie Wäscherei und Küche gemeinsam betreiben und ihre Kompetenzen bei Preisverhandlungen bündeln. Wirtschaftlich gute Ergebnisse konnten dabei sowohl bei breiten als auch tiefen Beziehungen innerhalb eines Krankenhauses erreicht werden. Ebenfalls erzielten die Krankenhäuser positive Effekte, die mit niedergelassenen Ärzten beziehungsweise Reha-Einrichtungen im Rahmen von breiten Kooperationsvereinbarungen kooperieren.
Allerdings: Wer sowohl administrative Partnerschaften mit anderen Krankenhäusern als auch mit Ärzten oder Reha-Einrichtungen eingeht, muss mit spürbar negativen Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis rechnen. „So kann eine Kooperation auch das Gegenteil dessen bewirken, was eigentlich erreicht werden soll“, so Antonia Büchner, Forscherin am Hamburg Center for Health Economics. „Eine Erklärung hierfür können größere administrative Aufwendungen für das Handling der unterschiedlichen Partnerschaften und ein exponentieller Anstieg der Transaktionskosten sein.“
Mehr Breite als Tiefe
Generell gilt: Kooperationen in der Breite sind immer denjenigen in der Tiefe vorzuziehen. Dies betrifft im Besonderen auch die Beziehungen zwischen Krankenhäusern und Ärzten beziehungsweise Reha-Einrichtungen: Die besten wirtschaftlichen Ergebnisse erzielten die Krankenhäuser, die auf viele Partner gesetzt haben.
„Einzelne Kooperationen sollten daher immer im Gesamtkontext der Krankenhausstrategie betrachtet werden und nicht eine Einzelentscheidung sein“, empfiehlt Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE. „Diese Forschungsarbeit zeigt, dass bereits die Wahl der Kooperationsebene eine grundsätzliche Tendenz über den wirtschaftlichen Erfolg einer Partnerschaft liefert.“
Die Datengrundlage der Studie setzt sich aus drei Quellen zusammen: eine bundesweite Befragung von Krankenhausgeschäftsführungen, Kennzahlen aus den Jahresabschlüssen der Krankenhäuser sowie Daten zur Raum- und Stadtentwicklung. Insgesamt nahmen an der Erhebung rund 20 Prozent der deutschen Krankenhäuser teil.
Originalbeitrag
Vera Antonia Büchner, Vera Hinz, Jonas Schreyögg
Cooperation for a competitive position: The impact of hospital cooperation behavior on organizational performance
Angenommen: Health Care Management Review (im Druck)
Über das HCHE
Das Hamburg Center for Health Economics ist ein gemeinsames Forschungszentrum der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). 2010 gegründet, gehört das HCHE heute bereits zu den größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Mehr als 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Ökonomie und Medizin arbeiten gemeinsam an Lösungen aktueller und künftiger Fragestellungen der Gesundheitsversorgung. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Über Produktivität²
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Verbundprojekts „Produktivität²: Produktive Innovationsprozesse zur Erhöhung der Produktivität von Gesundheitsdienstleistern“ erforscht die Universität Hamburg gemeinsam mit mehreren Partnern verschiedene Fragestellungen im Bereich der Krankenhausproduktivität.
HCHE Research Results live: Neue Forschungsergebnisse zu Qualität im Krankenhaus (28.03.2014)
28. März 2014
HCHE Research Results live: Neue Forschungsergebnisse zu Qualität im Krankenhaus
Woran erkenne ich als Patient die Qualität eines Krankenhauses? Wie lässt sich diese messen und vergleichen? Wie beeinflusst der Ressourceneinsatz die Qualität der Behandlung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung „Qualität im Krankenhaus – Evidenzbasierte Perspektive für die Versorgungssteuerung“, die das Hamburg Center for Health Economics (HCHE) heute in Hamburg durchführt. „Die Qualität in der Versorgung bekommt gerade nicht zuletzt durch die geplante Gesundheitspolitik der neuen Koalition eine besondere Aufmerksamkeit“ so Prof. Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor beim HCHE. Das HCHE stellt hierzu zwei gesundheitsökonomische Forschungsarbeiten vor und diskutiert diese mit Dr. Christoph Straub, Vorstandsvorsitzender der BARMER GEK, und Dr. Ulrich Wandschneider, Vorsitzender der Asklepios-Konzerngeschäftsführung, vor rund 120 Gästen.
Mit der Qualitätsoffensive für die stationäre Versorgung, die im Koalitionsvertrag verankert ist, sind verschiedenste Maßnahmen verbunden, unter anderem auch für den Laien verständliche, transparente und vergleichbare Qualitätsberichte der Kliniken. Genau hier setzt der Qualitätsindex, eines der beiden vorgestellten Forschungsarbeiten, an: Mit dem Index, der zusammen mit der BARMER GEK entwickelt wurde, sollen Aussagen zu einem Leistungsbereich für möglichst viele Krankenhäuser getroffen werden. Das Krankenhaus erhält für den betroffenen Leistungsbereich eine aggregierte Indexbewertung, die anschließend als Ampelsystem dargestellt wird. Patientinnen und Patienten können darüber dann gezielt das Krankenhaus wählen, das mit grün, also mit gut, bewertet wurde. Wesentlich ist, dass die Gewichtung auf Basis statistischer und objektiver Kriterien und nicht auf Grund subjektiver Einschätzungen erfolgt. „Ziel des Qualitätsindex ist es, Patientinnen und Patienten ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem sie in Zukunft gezielt das beste Krankenhaus für die angestrebte Behandlung wählen können“, erklärt Jun.-Prof. Dr. Rudolf Blankart, Forscher am HCHE. Exemplarisch wurde der kardiologisch-stationäre Bereich zur Entwicklung des Qualitätsindex herangezogen. „Auf Basis dieser ersten fundierten Forschungsarbeit werden wir nun weitere Schritte anstreben, zum Beispiel eine Übertragung auf andere Leistungsbereiche“, so Dr. Christoph Straub von der BARMER GEK. Der Qualitätsindex erhöhe die Transparenz und könne darüber hinaus den Wettbewerb unter den Krankenhäusern zum Wohle der Patientinnen und Patienten erhöhen; allerdings werde ein Einsatz in der Praxis noch eine Weile dauern, so Straub.
In dem zweiten Forschungsprojekt ging es darum zu überprüfen, ob Veränderungen des Ressourceneinsatzes zu messbaren Änderungen der Versorgungsqualität führen. So zeigt die Studie „Cost & Quality: Wie beeinflusst der Ressourceneinsatz die Qualität der Behandlung?“ am Beispiel des Herzinfarktes, dass mehr Ressourcen tatsächlich auch mehr Qualität bringen. Dabei konnten die Forscher um Prof. Dr. Tom Stargardt vom HCHE ermitteln, dass die Erhöhung der Ressourcen um 100 Euro die 1-Jahres-Sterblichkeit des durchschnittlichen Patienten in der Stichprobe von 8,70 auf 8,66 Prozent senkt. Umgerechnet entspricht dies Mehrausgaben von circa 267.000 Euro für ein zusätzlich gewonnenes Lebensjahr. Die Kosten können sich dabei sowohl auf mehr Personal als auch auf technologieintensivere Leistungen beziehen. „Diese Forschung verdeutlicht den Trade-off zwischen Ressourceneinsatz und Qualität“, so Prof. Tom Stargardt und verweist darauf, dass „bei gegebenen Budget Mehrausgaben auf der einen Seite immer auch zu einem geringeren Budget für eine andere Indikation führen. Dies ist letztendlich eine politische beziehungsweise gesellschaftliche Entscheidung.“ Untersucht wurden für diese Studie die Daten von über 12.000 Herzinfarktpatienten, die Messung der Qualität bezog sich auf den Erfolg der medizinischen Maßnahme.
Der größte privatwirtschaftliche Klinikbetreiber in Europa, die Asklepios Kliniken, „hat sich die wichtigen Themen Qualität und Transparenz schon seit vielen Jahren auf die Fahnen geschrieben und nimmt deshalb in vielen Bereichen eine Vorreiterrolle ein. Zum Beispiel als Mitbegründer des Online-Portals Qualitätskliniken.de, auf dessen Seiten Interessierte und Patienten schon heute weit mehr zur Qualität und vor allem zur Patientensicherheit in den teilnehmenden Kliniken erfahren als gesetzlich vorgeschrieben ist“, erklärt Dr. Ulrich Wandschneider.
Am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) forschen mittlerweile über 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen an Lösungen aktueller und künftiger Fragestellungen. Ziel ist es, eine vielschichtige Betrachtung wichtiger gesundheitspolitischer Themen zu erreichen. Als gemeinsames Institut der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) kombinieren wir wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Kompetenzen mit medizinischer Expertise. Schon heute ist das 2010 gegründete HCHE eines der größten gesundheitsökonomischen Zentren in Europa. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Studie: Krankenhäuser arbeiten produktiver, wenn Aufsichtsgremien sich einmischen (04.12.2013)
04. Dezember 2013
Krankenhäuser arbeiten produktiver, wenn Aufsichtsgremien sich einmischen
Eine aktive Einflussnahme von Aufsichtsgremien auf die strategische Zielplanung in Krankenhäusern bringt einen positiven Effekt auf das Geschäftsergebnis. Dies ist ein zentrales Ergebnis der Studie “The impact of the board’s strategy-setting role on board-management relations and hospital performance“, die jetzt am Hamburg Center for Health Economics (HCHE) veröffentlicht wurde. Erstmals befragte ein Forscherteam unter der Leitung von Professor Dr. Jonas Schreyögg Aufsichtsgremien von 200 deutschen Krankenhäusern zu ihrer Rolle in der strategischen Zielplanung.
Die Studie kombiniert darüber hinaus Informationen aus separaten Befragungen der Geschäftsführung und des Aufsichtsgremiums sowie Daten aus Jahresabschlüssen und Qualitätsberichten. Neben der Einflussnahme der Aufsichtsgremien auf die strategische Zielplanung wurde die Qualität der Zusammenarbeit zwischen interner Krankenhausleitung und Aufsichtsgremien, die Diversität sowie der Aktivitätsgrad des Aufsichtsgremiums untersucht.
Aufsichtsgremiumsmitglieder, die sich aktiv in die strategische Zielplanung einbringen, erhöhen die Krankenhausproduktivität. Die Geschäftsführung wiederum ist gut darin beraten, die Rolle des Aufsichtsgremiums zu stärken und diese in ihre strategischen Planungen einzubinden. Gleichzeitig verschlechtert sich jedoch die Zusammenarbeit beider Parteien, wenn der Einfluss des Aufsichtsgremiums zu stark wird. Dabei ist ein gutes Verhältnis zwischen Aufsichtsgremium und Geschäftsführung essenziell: „Eine gute Zusammenarbeit wirkt sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit und Produktivität des Krankenhauses aus“, so Antonia Büchner, wissenschaftliche Mitarbeiterin am HCHE. „Beide Seiten sollten daher ein vertrauensvolles und kooperatives Verhältnis entwickeln.“
Das Verhältnis beider Parteien kann bereits durch die Diversität in der Besetzung des Aufsichtsgremiums verbessert werden, beispielsweise indem auf einen entsprechenden Anteil Frauen, eine berufliche Heterogenität und eine gemischte Altersstruktur gesetzt wird. Zudem stellt die Vielfalt der Mitglieder einen wichtigen Faktor unter anderem für die Rekrutierung von Mitarbeitern dar. Allerdings fanden die Forscher heraus, dass eine größere Diversität die Krankenhausproduktivität reduziert. „Insgesamt betrachtet empfiehlt sich eine gute Balance sowohl bei der Besetzung des Aufsichtsgremiums als auch bei der Einflussnahme des Gremiums auf die strategische Zielplanung“, so Professor Dr. Jonas Schreyögg, wissenschaftlicher Direktor des HCHE.
Die Studie „The impact of the board’s strategy-setting role on board-management relations and hospital performance“ von V.A. Büchner, J. Schreyögg (beide HCHE) und C. Schultz (Universität Kiel) ist in
Health Care Management Review erschienen und Teil des Verbundprojekts „Produktivtät²“ der Universitäten Hamburg und Kiel, des Deutschen Krankenhausinstituts und des IAT Gelsenkirchen. Ziel ist es, Konzepte zur Messung von Produktivität der Leistungserstellung sowie der Produktivität von Innovationen auf Institutionen des Gesundheitswesens, insbesondere
auf Krankenhäuser, zu übertragen und weiter zu entwickeln. Das Projekt wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF, 01FL10055).
Über das HCHE
Das Hamburg Center for Health Economics ist das gesundheitsökonomische Forschungsinstitut der Universität Hamburg und des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE) und eines der größten Zentren dieser Art in Europa. Mehr als 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus Ökonomie und Medizin arbeiten an Lösungen aktueller und künftiger Fragestellungen der Gesundheitsversorgung. Unser Ziel ist es, eine vielschichtige Betrachtung wichtiger gesundheitspolitischer Themen zu erreichen. Als eines von vier gesundheitsökonomischen Zentren in Deutschland erhält das HCHE eine Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung für den weiteren Ausbau.
Gesundheitsökonomie studieren: Neuer Masterstudiengang startet an der Uni Hamburg (06.05.2013)
06. Mai 2013
An der Universität Hamburg beginnt erstmalig zum Wintersemester 2013/14 der neue Masterstudiengang Health Economics & Health Care Management, der für spätere Fach- und Führungsaufgaben im Gesundheitswesen ausbildet. Die Studierenden erlangen im viersemestrigen Studium zunächst methodisches Wissen, um anschließend einen von zwei gesundheitsökonomischen Schwerpunkten zu wählen. Health Economics betrachtet das Gesundheitswesen aus volkswirtschaftlicher Perspektive und eignet sich vor allem für Studierende, die sich für eine berufliche Tätigkeit bei Ministerien, Behörden und Organisationen interessieren. Für spätere Aufgaben in Krankenhäusern, bei Krankenkassen, Pharmaunternehmen oder Verbänden empfiehlt sich der Schwerpunkt Health Care Management, der die betriebswirtschaftliche Perspektive in den Fokus stellt. Beide Vertiefungen ermöglichen eine anschließende Arbeit in der Forschung. Das Studium endet nach zwei Jahren mit dem Abschluss Master of Science.
Der Studiengang wird ausgerichtet vom Fachbereich Sozialökonomie der Universität Hamburg in enger Kooperation mit dem Hamburg Center for Health Economics (HCHE). Das HCHE ist eines der größten Zentren für gesundheitsökonomische Forschung in Europa. Es unterstützt den neuen Masterstudiengang über die Programmgestaltung und Lehre hinaus und fördert insbesondere den Austausch mit der Wissenschaft, internationalen Forschungsinstituten und Vertretern aus der Praxis.
Voraussetzung für eine Bewerbung zum Master of Science Health Economics & Health Care Management ist ein Bachelor in Wirtschaftswissenschaften oder verwandten Studiengängen.
Voraussetzung für eine Bewerbung zum Master of Science Health Economics & Health Care Management ist ein Bachelor in Wirtschaftswissenschaften oder verwandten Studiengängen.
Weitere Informationen unter hier oder unter www.hche.de.
Studie: Wie Patienten und deren Angehörige Kliniken im Internet bewerten (12.12.2012)
12. Dezember 2012
Wie Patienten und deren Angehörige Kliniken im Internet bewerten
Forscher des Hamburg Center for Health Economics (HCHE) haben gemeinsam mit Kollegen der Universität Freiburg und in Kooperation mit dem Online-Bewertungsportal von „MedizInfo“ Motive, Inhalte und Charakteristika von Klinik-Bewertungen im Internet untersucht. In der Studie „Electronic Word of Mouth about Medical Services“ wurden mehr als 800 Personen befragt und deren Beurteilungen auf www.klinikbewertungen.de analysiert. Dabei wurde berücksichtigt, ob Patienten oder Angehörige den stationären Aufenthalt bewertet hatten. Zentrales Ergebnis: Patienten urteilen positiver als Angehörige und vor allem dann, wenn sie das Krankenhaus selbst gewählt haben.
Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass insbesondere dann Beurteilungen im Internet abgeben werden, wenn entweder sehr positive und sehr negative Erfahrungen gemacht wurden. Außerdem überwiegen altruistische gegenüber egoistischen Motiven. Ein negativer Bericht hängt eher mit dem Bedürfnis zusammen, andere zu warnen als sich zu rächen. Ein positiver Bericht geht mehr mit dem Bedürfnis einher, anderen bei der Entscheidung in der Krankenhauswahl zu helfen als seine positiven Gefühle mitzuteilen. Insgesamt waren über 70 Prozent der Befragten „eher zufrieden“ oder „sehr zufrieden“ mit dem Krankenhausaufenthalt.
Eine gute Bewertung ist dabei auch vom Betroffenheitsgrad abhängig: So schreiben Patienten selbst durchschnittlich positiver und ausführlicher als Angehörige. Letztere geben häufiger an, durch das Bedürfnis getrieben zu sein, andere zu warnen beziehungsweise sich für negative Gefühle zu rächen. „Krankenhäuser können durch eine verbesserte Information und Betreuung von Angehörigen Einfluss auf die Gesamtbeurteilung nehmen“, berichtet Prof. Dr. Vera Hinz vom HCHE.
Auch die Frage, wer für die Wahl des Krankenhauses zuständig ist, beeinflusst die Bewertungen: Wer sich das Krankenhaus selbst aussucht, ist in der Regel zufriedener mit seinem Aufenthalt und möchte seine positiven Gefühle auch mitteilen. Dagegen beurteilen Patienten, die als Notfälle eingeliefert wurden, ihren Aufenthalt durchschnittlich am schlechtesten. Die Einweisungsart nimmt zusätzlich Einfluss auf die Inhalte der Bewertung. Notfallpatienten schreiben ausführlich über die medizinische Behandlung, eigene Wahl-Patienten detaillierter über die Komfortleistungen. „Eine stärkere Patientensouveränität im Gesundheitswesen resultiert potentiell in positivere Erfahrungsberichte“, so Vera Hinz.
Das Forschungsprojekt wurde von Prof. Dr. Vera Hinz, Hamburg Center for Health Economics, Universität Hamburg, Dr. Florian Drevs, Lehrstuhl für Marketing und Gesundheitsmanagement, Universität Freiburg, und Jürgen Wehner, Betreiber des Portals klinikbewertungen.de, geleitet.
Hamburg Center for Health Economics feierlich eröffnet (25.10.2012)
25. Oktober 2012
Hamburg Center for Health Economics feierlich eröffnet
Heute, am 25. Oktober, ist in der Freien und Hansestadt Hamburg das in Deutschland größte Zentrum für gesundheitsökonomische Forschung offiziell eröffnet worden. Seit den ersten Gründungsaktivitäten des Hamburg Center for Health Economics – kurz HCHE – sind zwei Jahre vergangen. Zeit, in der sich Ökonomen der Fakultäten für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Hamburg und Mediziner des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf konstituiert und in interdisziplinärer Zusammenarbeit erste Forschungsprojekte zum Abschluss gebracht haben.
Prof. Dr. Dieter Lenzen, Präsident der Universität Hamburg: „Die interdisziplinäre Beschäftigung mit Problemen des Gesundheitssystems vor dem Hintergrund von Kostensteigerung und Leistungsabsenkung im Gesundheitsbereich hat eine besondere gesellschaftliche Bedeutung.“
Inzwischen erforschen am HCHE über 50 Wissenschaftler die Perspektiven und Potenziale des Gesundheitswesens von morgen und machen Studierende mit den zentralen Fragen und Herausforderungen des Gesundheitssystems vertraut. „Wir möchten zu den führenden gesundheitsökonomischen Zentren in Europa gehören“, so HCHE-Direktor Prof. Dr. Jonas Schreyögg.
Die Gesundheitsversorgung ist ein gesellschaftlich sehr wichtiges Thema. Hinzu kommt, dass die Gesundheitswirtschaft heute schon mit Abstand die Branche mit den meisten Beschäftigen in Deutschland und damit ein enormer Wirtschaftsfaktor ist. Das HCHE nimmt als eines von vier vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Zentren in Deutschland eine einflussreiche Stellung für die effiziente Gestaltung des zukünftigen Gesundheitssystems ein. Die Forschungsergebnisse finden Niederschlag in den Planungen der gesundheitspolitischen Entscheider, der Krankenkassen und Versorger wie Krankenhäuser und Pflegedienste oder auch von Industrieunternehmen.
An der offiziellen Eröffnung des HCHE am Standort an der Esplanade 36 in Hamburg haben zahlreiche prominente Vertreter aus Politik, dem universitären Bereich, den Krankenkassen, den Krankenhäusern, der Ärzteschaft und der Industrie teilgenommen. So hob Wissenschaftsstaatsrat Dr. Horst-Michael Pelikahn die Stellung Hamburgs als Wissenschaftsstadt und Gesundheitsmetropole hervor, mit zahlreichen exzellenten Hochschulen und Forschungseinrichtungen, dem UKE und innovativen Unternehmen der Gesundheitswirtschaft. „Medizinische und ökonomische Forschung interdisziplinär anzugehen, ist ein vielversprechender Ansatz des HCHE, da hier wichtige Themen in unserer Gesellschaft vor dem Hintergrund der großen wirtschaftlichen Bedeutung der Gesundheitsbranche aufgegriffen werden.“
Die Vertreter der beteiligten Fakultäten betonten die hohe Forschungsqualität. So die Dekanin der Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Prof. Dr. Gabriele Löschper: „Die Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften freut sich, dass wir unseren Anspruch und unser Vermögen unter Beweis stellen, mit unserer hohen Forschungskompetenz Beiträge zu gesellschaftlich hochrelevanten Themen zu leisten. Es ist ein beiderseitiger Gewinn, dass die vielfältigen Fragen zur Gesundheitsökonomie in einer fruchtbaren Zusammenarbeit der Fakultät Wirtschafts-und Sozialwissenschaften und der Fakultät Medizin bearbeitet werden.“
Prof. Dr. Dr. Uwe Koch-Gromus, Dekan der medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf: „Am UKE gibt es seit einigen Jahren eine national wie international hoch eingeschätzte Versorgungsforschung. Für die Bewertung bestehender wie auch neu zu entwickelnder Angebote im Gesundheitswesen ist die Einbeziehung der Gesundheitsökonomie von zentraler Bedeutung. Deshalb sind wir sehr froh, mit dem Hamburg Center for Health Economics (HCHE) über eine deutschlandweit einzigartige Einrichtung zu verfügen.“
Hintergrundinformationen und Bildmaterial stehen ab Freitag, 26. Oktober 2012, auf Anfrage zur Verfügung. Bitte schreiben Sie eine E-Mail an elena.granina@wiso.uni-hamburg.de<span style="color: #000000;"></span>(elena.granina"AT"wiso.uni-hamburg.de) oder andrea.buekow@wiso.uni-hamburg.de.